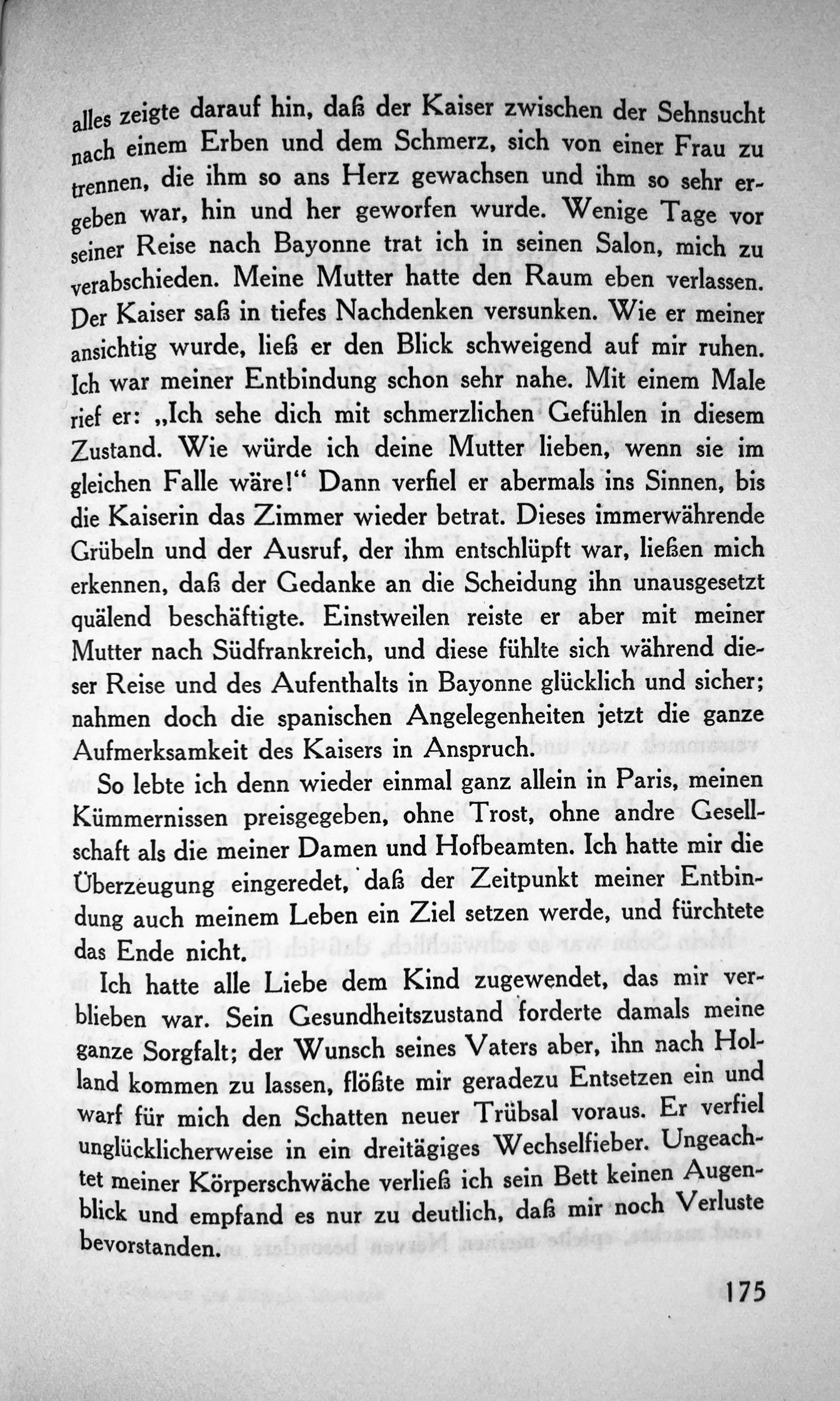Napoleon’s police minister was actually working against Napoleon’s best interests.
ihn noch was mich betraf hatte Vorschub leisten können. Er hatte zahlreiche Feinde, die es sich in ihrem Übelwollen angelegen sein liessen, ihm zu schaden, brauchte ihnen diese Aufgabe also nicht zu erleichtern. Auch das Wort Scheidung hatte mich verblüfft, und mein Erstaunen lie erst nach, wie mir später meine Mutter mitteilte, der Polizeiminister Fouché habe ihr gesagt, ganz Frankreich wünsche die Trennung, der Kaiser würde früher oder später, sowenig er jetzt daran denke, sich dazu gezwungen sehen. Er ging sogar so weit, ihr den Entwurf eines Briefes vorzulegen, den er ihr an den Senat zu richten riet, wobei er sie zu bestimmen suchte, den ersten Schritt in der Scheidungsangelegenheit zu tun. Die Auflösung der Ehe war mir bisher als etwas ganz Unmögliches erschienen; aber das vorangegangene Gespräch mit dem Kaiser gab mir die Befürchtung ein, er möchte um das Vorhaben Fouchés wissen. Die Kaiserin schwankte, und ich wagte nicht, ihr in einer so heiklen Sache Rat zu erteilen. Wie sie mich aber dazu drängte, sagte ich, an ihrer Stelle würde ich zum Kaiser gehen, ihm den Vorwurf machen, mich hinterhältig behandelt zu haben, ihn bitten, sich offen auszusprechen, ihm erklären, ich bliebe keinen Tag mehr bei ihm, wenn er mir den Wunsch, sich zu trennen, zu verstehen gäbe. Ich liess es mir zugleich angelegen sein, auf meine Mutter einzuwirken, sie möchte sich in ester Linie auf ihr eigenes Gefühl verlassen, das vielleicht infolge der Liebe zum Kaiser sich von dem meinen einigermaßen unterschied, und sie entschloss sich denn auch, nach langen Besprechungen mit ihren Damen und besonders mit Frau von Rémusat, der Freundin Talleyrands, der die Kaiserin das größte Vertrauen schenkte, Fouché zu antworten, das sie keine Schritte zu tun gedächte; sie sprach auch mit dem Kaiser nicht darüber, der nicht lange nachher von dem Rat erfuhr, den ihr Fouché gegeben hatte. Er machte meiner Mutter einen Vorwurf daraus, das sie ihm gegenüber nicht mit der Sprache herausgegangen war, erklärte ihr, Fouché habe aus eigenem Antrieb und ohne seine Einwilligung bei ihr vorgesprochen, und fragte sie nach ihrer Meinung. Sie erwiderte, sie könne es nie über sich gewinnen, etwas von sich aus zu verlangen, was sie von ihm entfernen würde; ihr Schicksal sei zu außergewöhnlich, als das es nicht von der Vorsehung besonders ausgezeichnet wäre; sie glaube beiden zum Verhängnis zu gereichen, wenn sie aus eigenem Willen sein Leben von dem ihren trennte. Der Kaiser zeigte sich gerührt, wurde wieder, was er stets für sie gewesen war, und das ganze Vorhaben schien in Vergessenheit zu geraten. Doch er hatte gleichwohl im Gemüte meiner Mutter den Eindruck von etwas Unheilvollem erregt. Die Gerüchte, die über die Scheidung in der Hauptstadt umliefen, wurden ihm ständig berichtet und störten sein Sicherheitsgefühl dermaßen, das ich mir oft sagen musste, es sei seiner Ruhe wegen zu bedauern, da die Scheidung noch nicht Tatsache geworden war.
Der Kaiser reiste nach Italien und ernannte den Vizekönig zum Fürsten von Venedig. Diese Ernennung gab zu denken. Ich konnte mich selbst nicht mehr zurechtfinden und kam auf den Gedanken, er habe die Scheidung eigentlich niemals ernstlich erwogen.
Während der Italienreise des Kaisers war meine Mutter häufig zu Besuch bei mir; denn seit meiner Rückkehr aus Paris musste ich dauernd liegen. Die Fürstlichkeiten, die ich damals in Fontainebleau persönlich empfangen hatte, besuchten meine Abende regelmäßig.
Sie hatten alle irgendwelche Vergünstigungen zu erbitten. Ihr trauriges Schicksal erregte meine Teilnahme, und ich gab mir alle Mühe, sie die Bittstellerrolle der Besiegten nicht fühlen zu lassen, die im Lande des Siegers zweifach in der Fremde sind. Sie schienen sich denn auch bei mir wohler zu fühlen als irgendwo sonst und kamen trotz allen Bällen und Festen der Hauptstadt regelmäßig, wenn auch nur auf kurze Zeit zu meinen Abenden. Oft sagten sie, sie meinten bei mir in der eigenen Familie zu sein und könnten sich auch von keiner Schwester bessere Ratschläge erwarten als die, die ich ihnen zu geben gewillt wäre. „Wäre ich in Verlegenheit," erklärte eines Tags der Großherzog von Würzburg, Bruder des Kaisers von Österreich, „so würde ich mich an Sie wenden und mich beraten lassen. Ich kann mir wohl denken, das meine Ratschläge gut gewesen sein müssen; waren sie doch vom reinsten Anteil am Unglück andrer eingegeben. Am Neujahrstag verteilte ich an alle meine Leute im Haus kleine Geschenke. Ich bat mir die Fürstlichkeiten bei dieser Gelegenheit zu Gaste. Es wurde ein richtiges Familienfest daraus. Unter andern Geschenken hatte ich durch Isabey das Bildnis jener jungen russischen Prinzessin malen lassen, die ihr Mann, der Herzog von Mecklenburg, so tief betrauerte; er erhielt das Bild, auf einer Schatulle gemalt, als Angebinde.
Die Rückkunft des Kaisers unterbrach diese freundlichen persönlichen Beziehungen. Er hatte sehr schroffe Ansichten über die Aufnahme der Fremden und wollte nichts davon wissen, das sie, abgesehen von den großen Empfängen, zugezogen würden.
Prinz Wilhelm von Preußen war eben angekommen, und da Preußen bedeutende Ansprüche durchzusetzen hatte, glaubte man in seiner Person die Ursache für diese strengen Befehle suchen zu sollen. Alle Fürstlichkeiten, die die Fernhaltung von unsern Kreisen übelgenommen hatten, warfen sie nun denen des Faubourg Saint-Germain in die Arme, wo sie sicherlich eine recht leichtfertige Sprache über den Kaiser zu hören bekamen, die auch jedenfalls ihren eigenen Ansichten entsprach. Der Kaiser sagte eines Tags, indem er mich schalt, weil ich die Fremden empfangen hatte: „Git es nicht liebenswürdige Franzosen genug, und muss man sich den an die Fremden halten, die uns doch nicht wirklich lieben können? Aber sie haben angenehme Manieren, und ihre Damen wollen gefallen." „Sire,“ erwiderte ich, indem ich ihn, von dem letzten Satz unangenehm berührt, unterbrach, „es liegt mir so viel an ihrer guten Meinung, das ich es mir angelegen sein lasse, ihnen zu gefallen." Er lächelte und schwieg. Von der Scheidung war jetzt nicht mehr die Rede. Aber alles zeigte darauf hin, das der Kaiser zwischen der Sehnsucht nach einem Erben und dem Schmerz, sich von einer Frau zu trennen, die ihm so ans Herz gewachsen und ihm so sehr ergeben war, hin und her geworfen wurde. Wenige Tage vor seiner Reise nach Bayonne trat ich in seinen Salon, mich zu verabschieden. Meine Mutter hatte den Raum eben verlassen. Der Kaiser saß in tiefes Nachdenken versunken. Wie er meiner ansichtig wurde, ließ er den Blick schweigend auf mir ruhen. Ich war meiner Entbindung schon sehr nahe. Mit einem Male rief er: „Ich sehe dich mit schmerzlichen Gefühlen in diesem Zustand. Wie würde ich deine Mutter lieben, wen sie im gleichen Falle wäre!" Dann verfiel er abermals ins Sinnen, bis die Kaiserin das Zimmer wieder betrat. Dieses immerwährende Grübeln und der Ausruf, der ihm entschlüpft war, liessen mich erkennen, das der Gedanke an die Scheidung ihn unausgesetzt quälend beschäftigte. Einstweilen reiste er aber mit meiner Mutter nach Südfrankreich, und diese fühlte sich während dieser Reise und des Aufenthalts in Bayonne glücklich und sicher; nahmen doch die spanischen Angelegenheiten jetzt die ganze Aufmerksamkeit des Kaisers in Anspruch.
So lebte ich denn wieder einmal ganz allein in Paris, meinen Kümmernissen preisgegeben, one Trost, ohne andre Gesellschaft als die meiner Damen und Hofbeamten. Ich hatte mir die Uberzeugung eingeredet, "das der Zeitpunkt meiner Entbindung auch meinem Leben ein Ziel setzen were, und fürchtete das Ende nicht. Ich hatte alle Liebe dem Kind zugewendet, das mir verblieben war. Sein Gesundheitszustand forderte damals meine sanze Sorgfalt; der Wunsch seines Vaters aber, ihn nach Holland kommen zu lassen, flösste mir geradezu Entsetzen ein und warf für mich den Schatten neuer Trübsal voraus. Er verfiel unglücklicherweise in in dreitägiges Wechselfieber. Ungeachtet meiner Körperschwäche verließ ich sein Bett keinen Augenblick und empfand es nur zu deutlich, das mir noch Verluste bevorstanden.
NEUNTES KAPITEL
Die Königin von Holland. Geburt Napoleons des Dritten.
In der Nacht vom 20. auf den 21. April 1808 gebar ich einen Sohn. Eine Tochter wäre mehr nach meinem Wunsch gewesen; aber die Nachricht rief bei meiner Mutter und dem Kaiser die größte Freude hervor, der längs der ganzen französisch-spanischen Grenze, wo er sich damals aufhielt, Kanonenschüsse abfeuern ließ. Für seine Politik war die Geburt eines zweiten Prinzen in der Familie ein glückliches Ereignis.
Ich hatte, um ihn zu benachrichtigen, Herrn von Villeneuve, meinen französischen, an meinen Mann den Grafen Bylandt, meinen holländischen Kämmerer, abgesandt. Der König ließ das Ereignis dem Volk verkünden, das unter seinem Balkon versammelt war, und nahm die üblichen Beglückwünschungen in Empfang. Ich habe später erfahren, da der Chirurg im Salon der Herren vom Dienst sich folgendermaßen äußerte: „Den Königinnen steht das Recht zu, vor der Zeit zu entbinden. Sie haben ja immer eine andre Rechnung als die übrigen Menschen.
Mein Sohn war so schwächlich, das ich fürchten musste, er werde mir unter der Geburt versterben. Man musste ihn in Wein baden und in Watte packen, um ihn ins Leben zurückzurufen. Mein eigenes war mir gleichgültig geworden. Bedrohliche Gedanken stellten mir nur mehr die Gewissheit, sterben zu müssen, vor Augen. Ich war so sehr darauf gefasst, das ich meinen Geburtshelfer fragte, ob ich noch einen Tag zu leben hätte. Mein Zustand erschien ihm unbegreiflich. Er verschlimmerte sich zusehends. Ein Besuch, den mir Herr von Talleyrand machte, spielte meinen Nerven besonders mit; er war bei der Geburt mines Kindes amtlich zugegen gewesen und hatte die Gewohnheit beibehalten, Puder zu gebrauchen; er duftete aber so stark, wie er sich mir näherte, um mich zu beglückwinschen, das ich kaum atmen konnte. Ich wagte freilich während der ganzen Zeit seiner Anwesenheit nichts zu sagen, aber es war mir sehr beklommen zumute.
Ich wohnte noch in Saint-Cloud, wie der Kaiser nach Erfurt reiste. Dort sollten alle Souveräne Deutschlands und der Zar sich treffen. Ich war Zeugin der Tränen, die meine Mutter beim Gedanken an diese Reise vergoss. Der Kaiser tröstete sie und sagte, die Begegnung sei nur ein politischer Akt und habe nicht das Geringste mit Familienverbindungsplänen zu tun, die man ihm zu unterstellen beliebte; es hatten tatsächlich die herzlichen Beziehungen zwischen dem Kaiser und dem Zaren zu Vermutungen wegen einer Ehe zwischen dem Kaiser und der Großherzogin Katherina geführt. Besagte Begegnung schien das herzlichste Freundschaftsverhältnis zwischen den beiden Kaisern gezeitigt zu haben. Man unterhielt sich überall eingehend darüber. Unter anderm hieß es, der Zar habe sich während eines von französischen Schauspielern gespielten Trauerspiels bei den Versen: „Die Freundschaft eines großen Manns ist eine Wohltat der Götter" (Voltaires ,,Ödipus") dem Kaiser zugewendet und ihn in die Arme geschlossen. Die Prinzessin von Baden hatte in Erfurt große Erfolge. Die so galante Art des Zaren kam dort zu ihren Gunsten ganz zur Geltung, und Duroc, der mir davon und auch von der Leidenschaft, die seit schon fünfzehn Jahren das Gemüt des Zaren erfüllte (für Maria Antnova Naryschkin), erzählte, setzte hinzu: „Er ist der einzige Mensch, der Eurer Majestät gefährlich werden könnte. Sie dürften Ihrer Seelenruhe wegen nicht mit ihm zusammentreffen; er würde sicherlich, trotz den Aufmerksamkeiten für Ire Kusine, allem untreu werden, was er liebt." „Sehr schmeichelhaft für mich, sagte ich, „ich glaube es aber keineswegs an mir zu haben, Gefallen zu erregen.“ - „Sie vermögen mehr,“ erwiderte er, „Sie bewegen einem das Gemüt