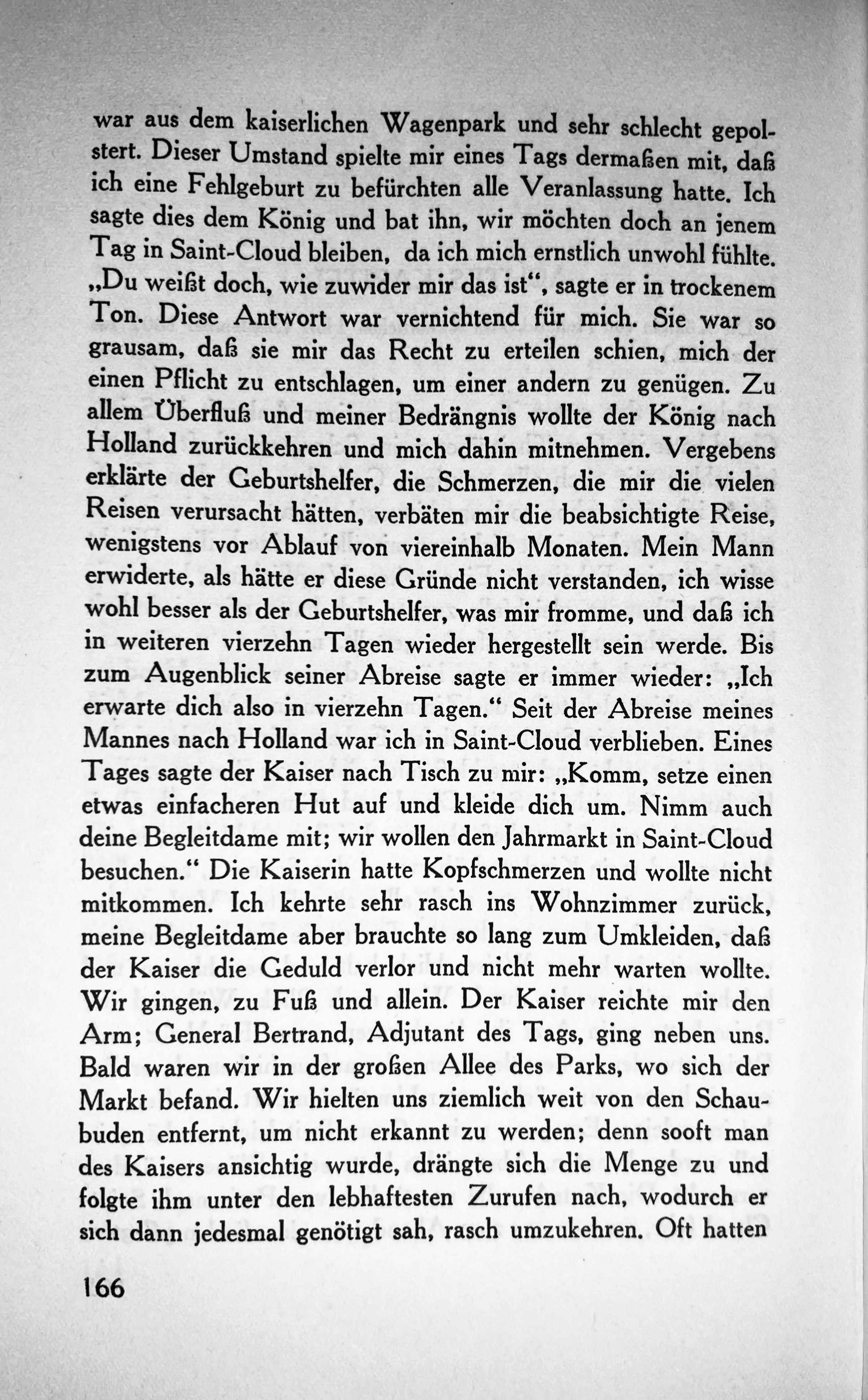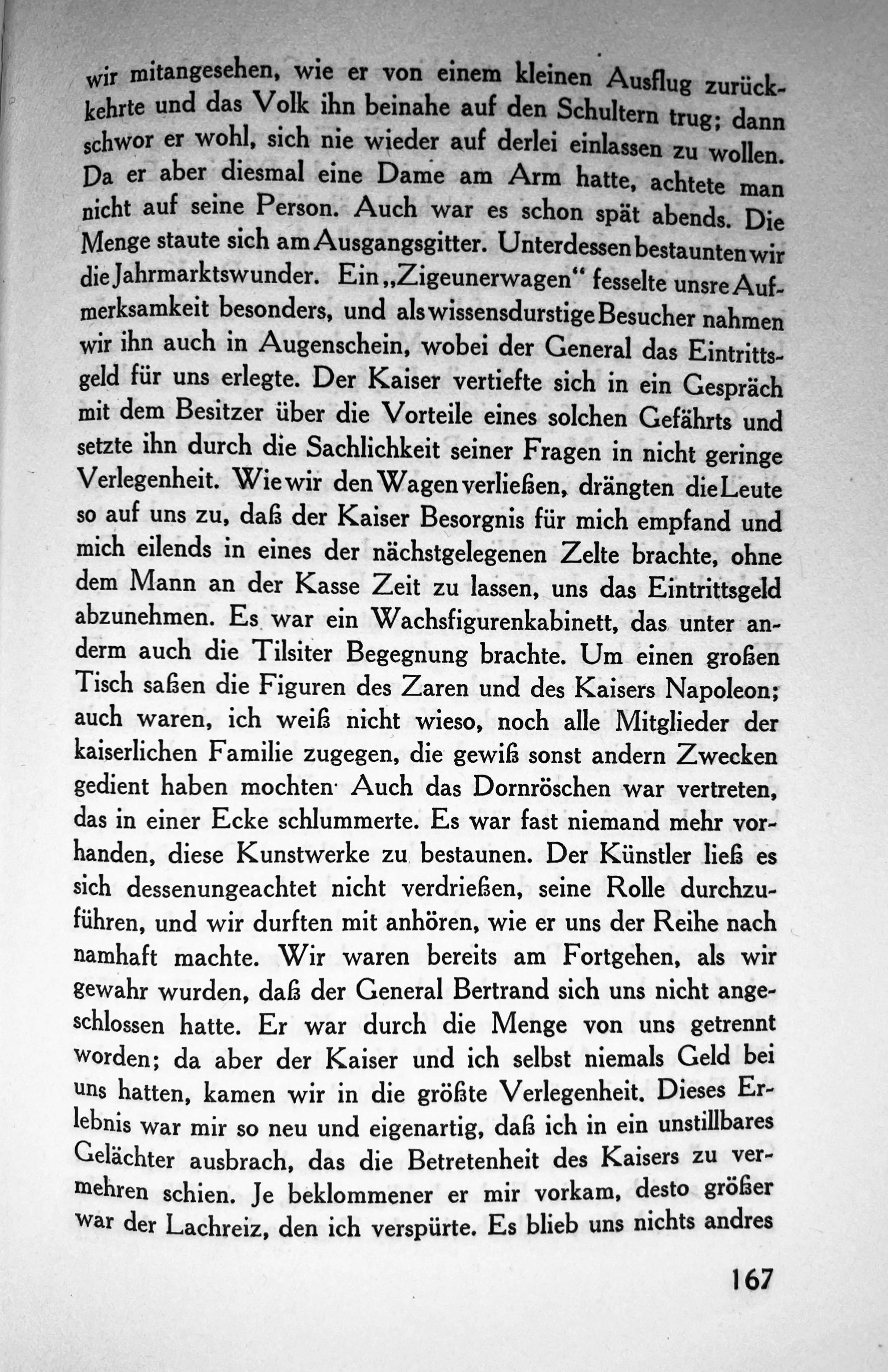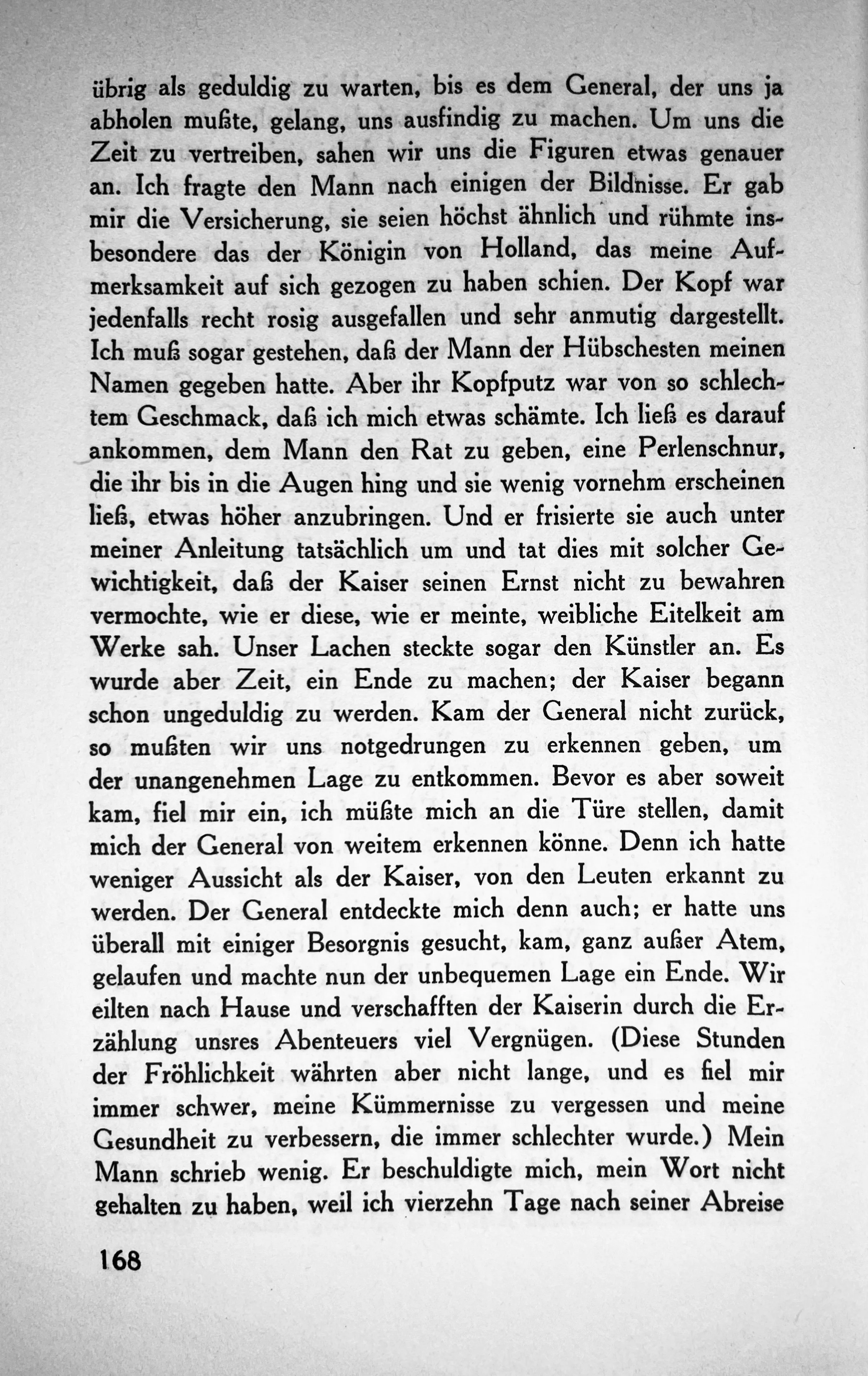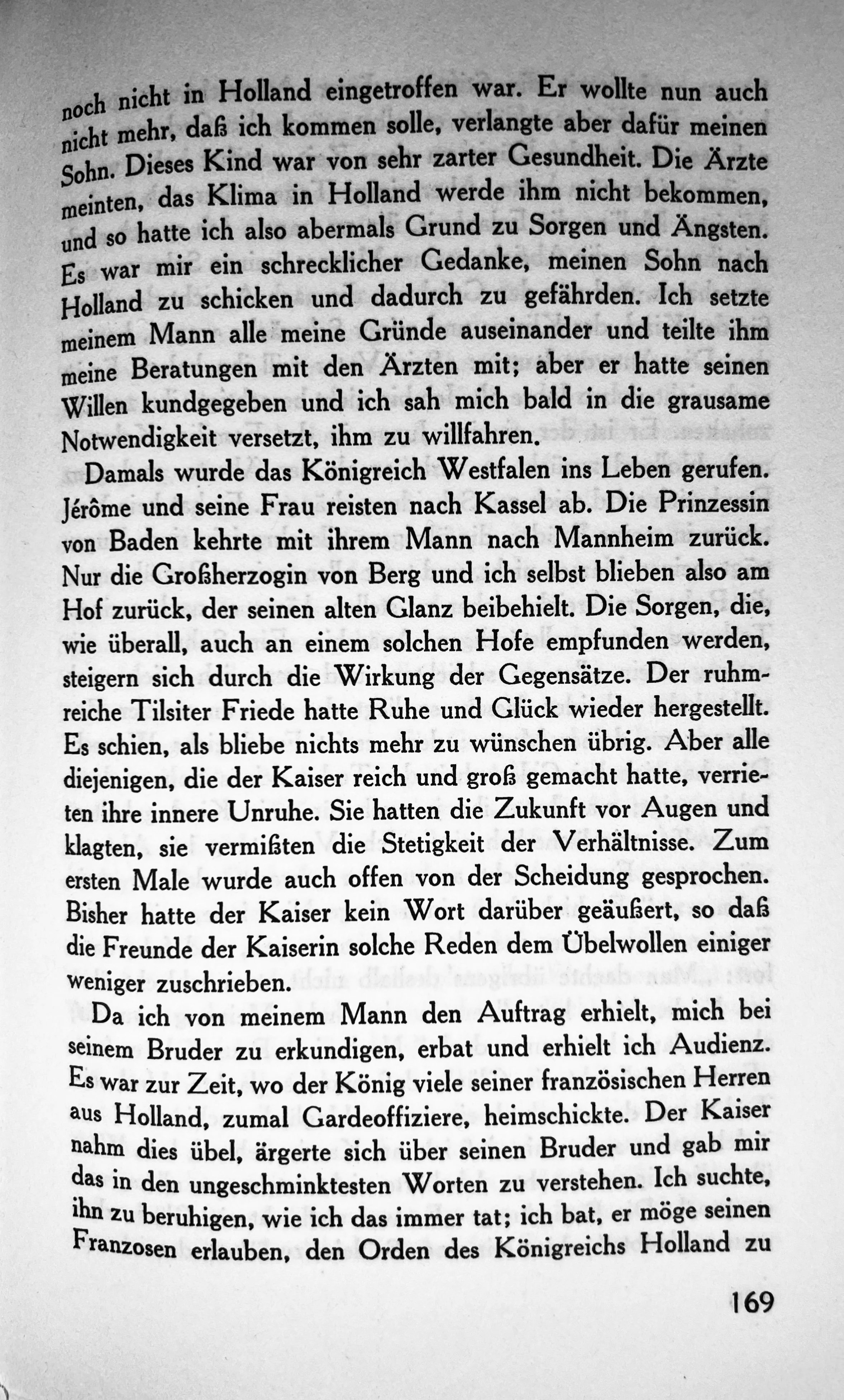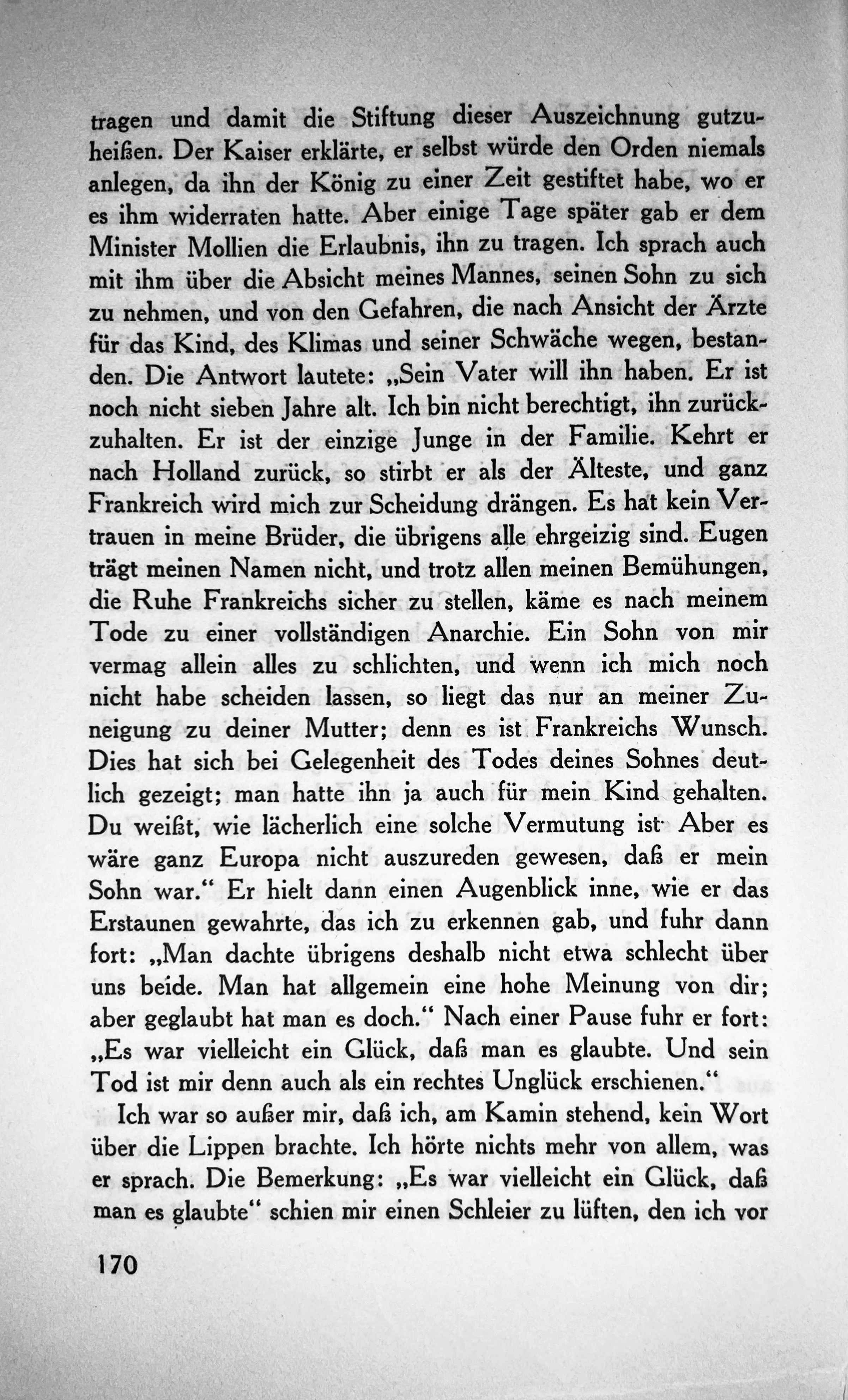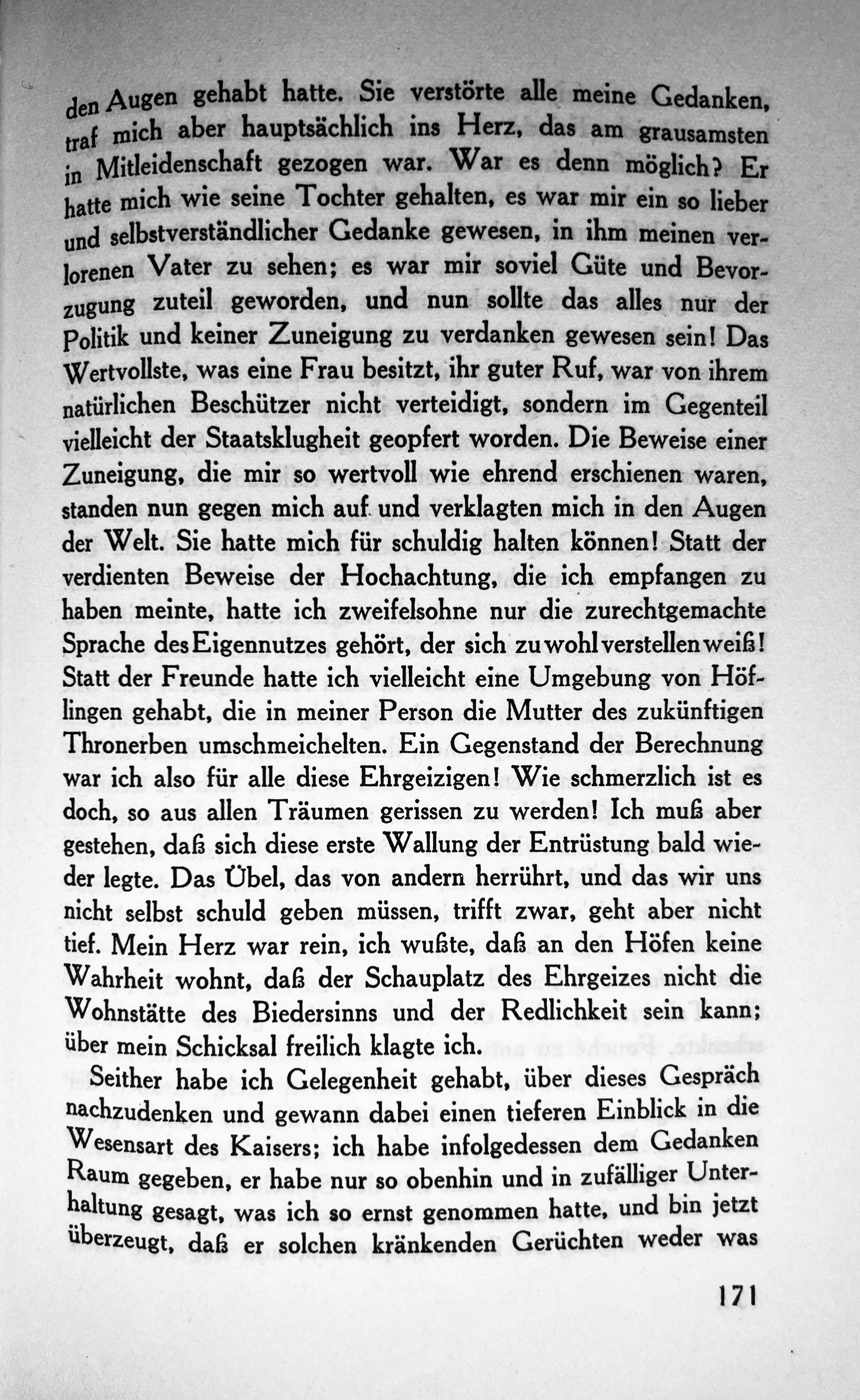She had no idea. Why was this so widely believed when it wasn’t actually true?
war aus dem kaiserlichen Wagenpark und sehr schlecht gepolstert. Dieser Umstand spielte mir eines Tags dermaken mit, daß ich eine Fehlgeburt zu befürchten alle Veranlassung hatte. Ich sagte dies dem König und bat ihn, wir möchten doch an jenem Tag in Saint-Cloud bleiben, da ich mich ernstlich unwohl fühlte. „Du weißt doch, wie zuwider mir das ist“, sagte er in trockenem Ton. Diese Antwort war vernichtend für mich. Sie war so grausam, das sie mir das Recht zu erteilen schien, mich der einen Pflicht zu entschlagen, um einer andern zu genügen. Zu allem Überfluss und meiner Bedrängnis wollte der König nach Holland zurückkehren und mich dahin mitnehmen. Vergebens erklärte der Geburtshelfer, die Schmerzen, die mir die vielen Reisen verursacht hätten, verbäten mir die beabsichtigte Reise, wenigstens vor Ablauf von viereinhalb Monaten. Mein Mann
erwiderte, als hätte er diese Gründe nicht verstanden, ich wisse wohl besser als der Geburtshelfer, was mir fromme, und das ich in weiteren vierzehn Tagen wieder hergestellt sein werde. Bis zum Augenblick seiner Abreise sagte er immer wieder: „Ich erwarte dich also in vierzehn Tagen." Seit der Abreise meines Mannes nach Holland war ich in Saint-Cloud verblieben. Eines Tages sagte der Kaiser nach Tisch zu mir: „Komm, setze einen etwas einfacheren Hut auf und kleide dich um. Nimm auch deine Begleitdame mit; wir wollen den Jahrmarkt in Saint-Cloud besuchen." Die Kaiserin hatte Kopfschmerzen und wollte nicht mitkommen. Ich kehrte sehr rasch ins Wohnzimmer zurück, meine Begleitdame aber brauchte so lang zum Umkleiden, das
der Kaiser die Geduld verlor und nicht mehr warten wollte.
Wir gingen, zu Fuß und allein. Der Kaiser reichte mir den Arm; General Bertrand, Adjutant des Tags, ging neben uns.
Bald warn wir in der großen Allee des Parks, wo sich der Markt befand. Wir hielten uns ziemlich weit von den Schaubuden entfernt, um nicht erkannt zu werden; denn sooft man des Kaisers ansichtig wurde, drängte sich die Menge zu und folgte ihm unter den lebhaftesten Zurufen nach, wodurch er sich dann jedesmal genötigt sah, rasch umzukehren. Oft hatten wir mitangesehen, wie er von einem kleinen Ausflug zurückkehrte und das Volk in beinahe auf den Schultern trug: dann schwor er wohl, sich nie wieder auf derlei einlassen zu wollen. Da er aber dismal eine Dame am Arm hatte, achtete man nicht auf seine Person. Auch war es schon spät abends. Die Menge state sich am Ausgangsgitter. Unterdessen bestaunten wir die Jahrmarktswunder. Ein ,,Zigeunerwagen" fesselte unsre Aufmerksamkeit besonders, und al wissensdurstige Besucher nahmen wir ihn auch in Augenschein, wobei der General das Eintrittsgeld für uns erlegte. Der Kaiser vertiefte sich in ein Gespräch mit dem Besitzer über die Vorteile eines solchen Gefährts und setzte in durch die Sachlichkeit seiner Fragen in nicht geringe Verlegenheit. Wie wir den Wagen verließen, drängten die Leute so auf uns zu, da der Kaiser Besorgnis für mich empfand und mich eilends in eines der nächstgelegenen Zelte brachte, ohne dem Mann an der Kasse Zeit zu lassen, uns das Eintrittsgeld abzunehmen. Es war in Wachsfigurenkabinett, das unter anderm auch die Tilsiter Begegnung brachte. Um einen großen Tisch salen die Figuren des Zaren und des Kaisers Napoleon; auch waren, ich weiß nicht wieso, noch alle Mitglieder der kaiserlichen Familie zugegen, die gewiss sonst andern Zwecken gedient haben mochten Auch das Dornröschen war vertreten, das in einer Ecke schlummerte. Es war fast niemand mehr vorhanden, diese Kunstwerke zu bestaunen. Der Künstler lief es sich dessenungeachtet nicht verdriessen, seine Role durchzuführen, und wir durften mit anhören, wie er uns der Reihe nach namhaft machte.
Wir waren berets am Fortgehen, als wir gewahr wurden, das der General Bertrand sich uns nicht angeschlossen hatte. Er war durch die Menge von uns getrennt worden; da aber der Kaiser und ich selbst niemals Geld bei uns hatten, kamen wir in die größte Verlegenheit. Dieses Erlebnis war mir so neu und eigenartig, das ich in ein unstillbares Gelächter ausbrach, das die Betretenheit des Kaisers zu vermehren schien. Je beklommener er mir vorkam, desto größer war der Lachreiz, den ich verspürte. Es blieb uns nichts andres übrig als geduldig zu warten, bis es dem General, der uns ja abholen mufte, gelang, uns ausfindig zu machen. Um uns die Zeit zu vertreiben, sahen wir uns die Figuren etwas genauer an. Ich fragte den Mann nach einigen der Bildnisse. Er gab mir die Versicherung, sie seen höchst ähnlich und rühmte insbesondere das der Königin von Holland, das meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben schien. Der Kopf war jedenfalls recht rosig ausgefallen und sehr anmutig dargestellt.
Ich muss sogar gestehen, daff der Mann der Hübschesten meinen Namen gegeben hatte. Aber ihr Kopfputz war von so schlechtem Geschmack, da ich mich etwas schämte. Ich lie es darauf ankommen, dem Mann den Rat zu geben, eine Perlenschnur, die ihr bis in die Augen hing und sie wenig vornehm erscheinen ließ, etwas höher anzubringen. Und er frisierte sie auch unter meiner Anleitung tatsächlich um und tat dies mit solcher Gewichtigkeit, da der Kaiser seinen Ernst nicht zu bewahren vermochte, wie er diese, wie er meinte, weibliche Eitelkeit am Werke sah. Unser Lachen steckte sogar den Künstler an. Es wurde aber Zeit, ein Ende zu machen; der Kaiser begann schon ungeduldig zu werden. Kam der General nicht zurück, so mussten wir uns notgedrungen zu erkennen geben, um der unangenehmen Lage zu entkommen. Bevor es aber soweit kam, fiel mir ein, ich müsste mich an die Türe stellen, damit mich der General von weitem erkennen könne. Den ich hatte weniger Aussicht als der Kaiser, von den Leuten erkannt zu werden. Der General entdeckte mich denn auch; er hatte uns überall mit einiger Besorgnis gesucht, kam, ganz ausser Atem, gelaufen und machte nun der unbequemen Lage en Ende. Wir eilten nach Hause und verschafften der Kaiserin durch die Erzählung unsres Abenteuers viel Vergnügen. (Diese Stunden der Fröhlichkeit währten aber nicht lange, und es fiel mir immer schwer, meine Kümmernisse zu vergessen und meine Gesundheit zu verbessern, die immer schlechter wurde.) Mein Mann schrieb wenig. Er beschuldigte mich, mein Wort nicht gehalten zu haben, weil ich vierzehn Tage nach seiner Abreise noch nicht in Holland eingetroffen war. Er wollte nun auch nicht mehr, daf ich kommen solle, verlangte aber dafür meinen Sohn. Dieses Kind war von sehr zarter Gesundheit. Die Ärzte meinten, das Klima in Holland were ihm nicht bekommen, und so hatte ich also abermals Grund zu Sorgen und Angsten.
Es war mir ein schrecklicher Gedanke, meinen Sohn nach Holland zu schicken und dadurch zu gefährden. Ich setzte meinem Mann alle meine Gründe auseinander und teilte ihm meine Beratungen mit den Ärzten mit; aber er hatte seinen Willen kundgegeben und ich sah mich bald in die grausame Notwendigkeit versetzt, ihm zu willfahren.
Damals wurde das Königreich Westfalen ins Leben gerufen. Jérôme und seine Frau reisten nach Kassel ab. Die Prinzessin von Baden kehrte mit ihrem Mann nach Mannheim zurück. Nur die Großherzogin von Berg und ich selbst blieben also am Hof zurück, der seinen alten Glanz beibehielt. Die Sorgen, die, wie überall, auch an einem solchen Hofe empfunden werden, steigern sich durch die Wirkung der Gegensätze. Der ruhmreiche Tilsiter Friede hatte Ruhe und Glück wieder hergestellt.
Es schien, als bliebe nichts mehr zu wünschen übrig. Aber alle diejenigen, die der Kaiser reich und grof gemacht hatte, verrieten ihre innere Unruhe. Sie hatten die Zukunft vor Augen und klagten, sie vermissten die Stetigkeit der Verhältnisse. Zum ersten Male wurde auch offen von der Scheidung gesprochen.
Bisher hatte der Kaiser kein Wort darüber geäussert, so das die Freunde der Kaiserin solche Reden dem Übelwollen einiger weniger zuschrieben. Da ich von meinem Mann den Auftrag erhielt, mich bei seinem Bruder zu erkundigen, erbat und erhielt ich Audienz. Es war zur Zeit, wo der König viele seiner französischen Herren aus Holland, zumal Gardeoffiziere, heimschickte. Der Kaiser nahm dies übel, ärgerte sich über seinen Bruder und gab mir das in den ungeschminktesten Worten zu verstehen. Ich suchte, ihn zu beruhigen, wie ich das immer tat; ich bat, er möge seinen Franzosen erlauben, den Orden des Königreichs Holland zu tragen und damit die Stiftung dieser Auszeichnung gutzuheissen. Der Kaiser erklärte, er selbst würde den Orden niemals anlegen, da ihn der König zu einer Zeit gestiftet habe, wo er es ihm widerraten hatte. Aber einige Tage später gab er dem Minister Mollien die Erlaubnis, ihn zu tragen. Ich sprach auch mit ihm über die Absicht meines Mannes, seinen Sohn zu sich zu nehmen, und von den Gefahren, die nach Ansicht der Arzte für das Kind, des Klimas und seiner Schwäche wegen, bestanden. Die Antwort lautete: „Sein Vater will ihn haben. Er ist noch nicht sieben Jahre alt. Ich bin nicht berechtigt, ihn zurückzuhalten. Er ist der einzige Junge in der Familie. Kehrt er nach Holland zurück, so stirbt er als der Alteste, und ganz Frankreich wird mich zur Scheidung drängen. Es hat kein Vertrauen in meine Brüder, die übrigens alle ehrgeizig sind. Eugen trägt meinen Namen nicht, und trotz allen meinen Bemühungen, die Ruhe Frankreichs sicher zu stellen, käme es nach meinem Tode zu einer vollständigen Anarchie. Ein Sohn von mir vermag allein alles zu schlichten, und wenn ich mich noch nicht habe scheiden lassen, so liegt das nur an meiner Zuneigung zu deiner Mutter; denn es ist Frankreichs Wunsch. Dies hat sich bei Gelegenheit de Todes deines Sohnes deutlich gezeigt; man hatte ihn ja auch für mein Kind gehalten. Du weisst, wie lächerlich eine solche Vermutung ist Aber es wäre ganz Europa nicht auszureden gewesen, das er mein Sohn war." Er hielt dann einen Augenblick inne, wie er das Erstaunen gewahrte, das ich zu erkennen gab, und fuhr dann fort: „Man dachte übrigens deshalb nicht etwa schlecht über uns beide. Man hat allgemein eine hohe Meinung von dir; aber geglaubt hat man es doch." Nach einer Pause fuhr er fort: „Es war vielleicht ein Glück, das man es glaubte. Und sein Tod ist mir denn auch als ein rechtes Unglück erschienen."
Ich war so ausser mir, das ich, am Kamin stehend, kein Wort über die Lippen brachte. Ich hörte nichts mehr von allem, was er sprach. Die Bemerkung: „Es war vielleicht ein Glück, das man es glaubte“ schien mir einen Schleier zu lüften, den ich vor den Augen gehabt hatte. Sie verstörte alle meine Gedanken, Traf mich aber hauptsächlich ins Herz, das am grausamsten in Mitleidenschaft gezogen war. War es denn möglich? Er hatte mich wie seine Tochter gehalten, es war mir ein so lieber und selbstverständlicher Gedanke gewesen, in hm meinen verlorenen Vater zu sehen; es war mir soviel Güte und Bevorzugung zuteil geworden, und nun sollte das alles nur der Politik und keiner Zuneigung zu verdanken gewesen sein! Das Wertvollste, was eine Frau besitzt, ihr guter Ruf, war von ihrem natürlichen Beschützer nicht verteidigt, sondern im Gegenteil vielleicht der Staatsklugheit geopfert worden. Die Beweise einer Zuneigung, die mir so wertvoll wie ehrend erschienen waren, standen nun gegen mich auf und verklagten mich in den Augen der Welt. Sie hatte mich für schuldig halten können! Statt der verdienten Beweise der Hochachtung, die ich empfangen zu haben meinte, hatte ich zweifelsohne nur die zurechtgemachte Sprache des Eigennutzes gehört, der sich zu wohl verstellen weiß! Statt der Freunde hatte ich vielleicht eine Umgebung von Höflingen gehabt, die in meiner Person die Mutter des zukünftigen Thronerben umschmeichelten. Ein Gegenstand der Berechnung war ich also für alle diese Ehrgeizigen! Wie schmerzlich ist es doch, so aus allen Träumen gerissen zu werden! Ich muss aber gestehen, das sich diese erste Wallung der Entrüstung bald wieder legte. Das bel, das von andern herrührt, und das wir uns nicht selbst schuld geben müssen, trifft war, geht aber nicht tief. Mein Herz war rein, ich wußte, das an den Höfen keine Wahrheit wohnt, da der Schauplatz des Ehrgeizes nicht die Wohnstätte des Biedersinns und der Redlichkeit sein kann; über mein Schicksal freilich klagte ich.
Seither habe ich Gelegenheit gehabt, über dieses Gespräch nachzudenken und gewann dabei einen tieferen Einblick in die Wesensart des Kaisers; ich habe infolgedessen dem Gedanken Raum gegeben, er habe nur so obenhin und in zufälliger Unterhaltung gesagt, was ich so ernst genommen hatte, und bin jetzt überzeugt, das er solchen kränkenden Gerüchten weder was