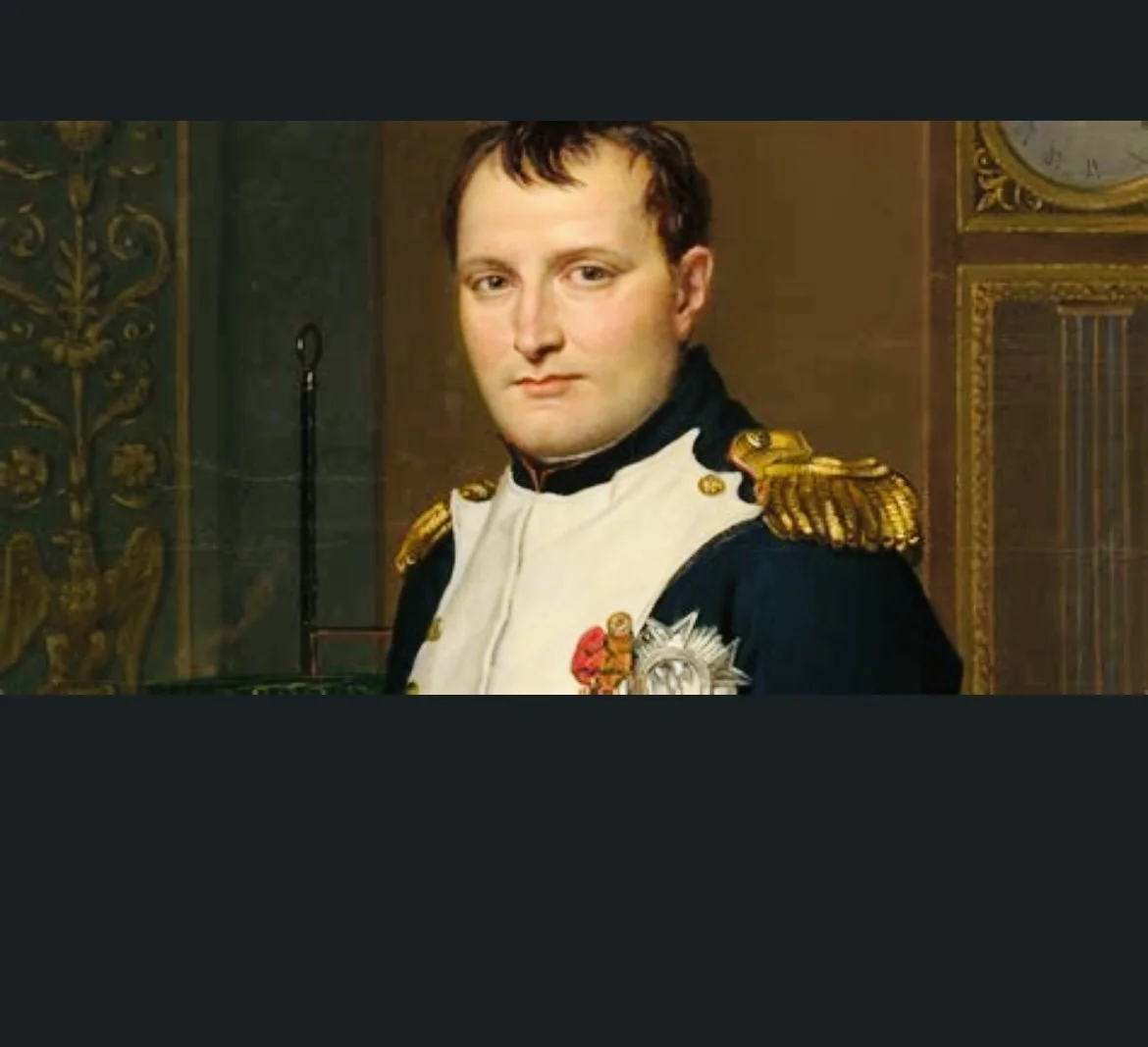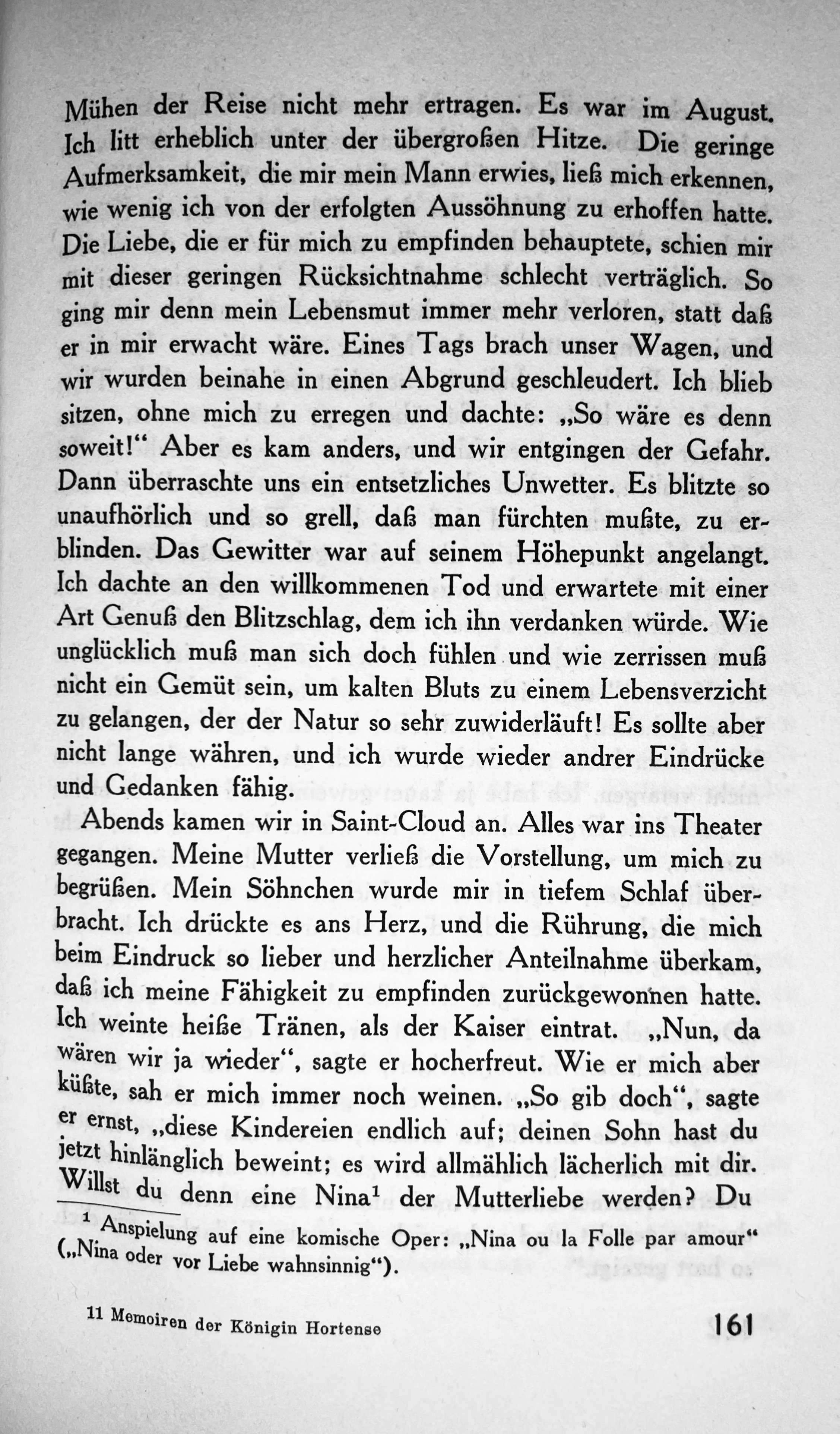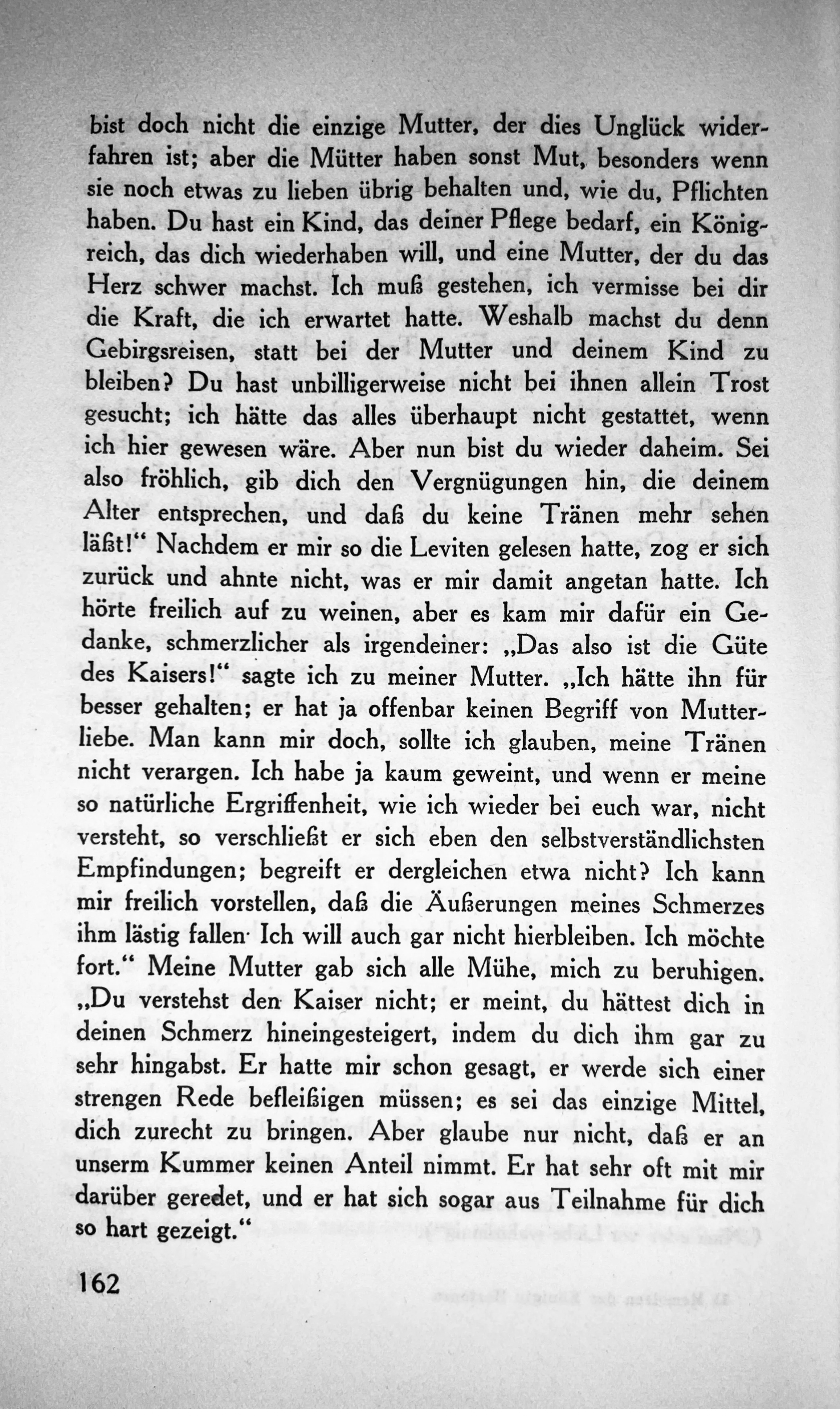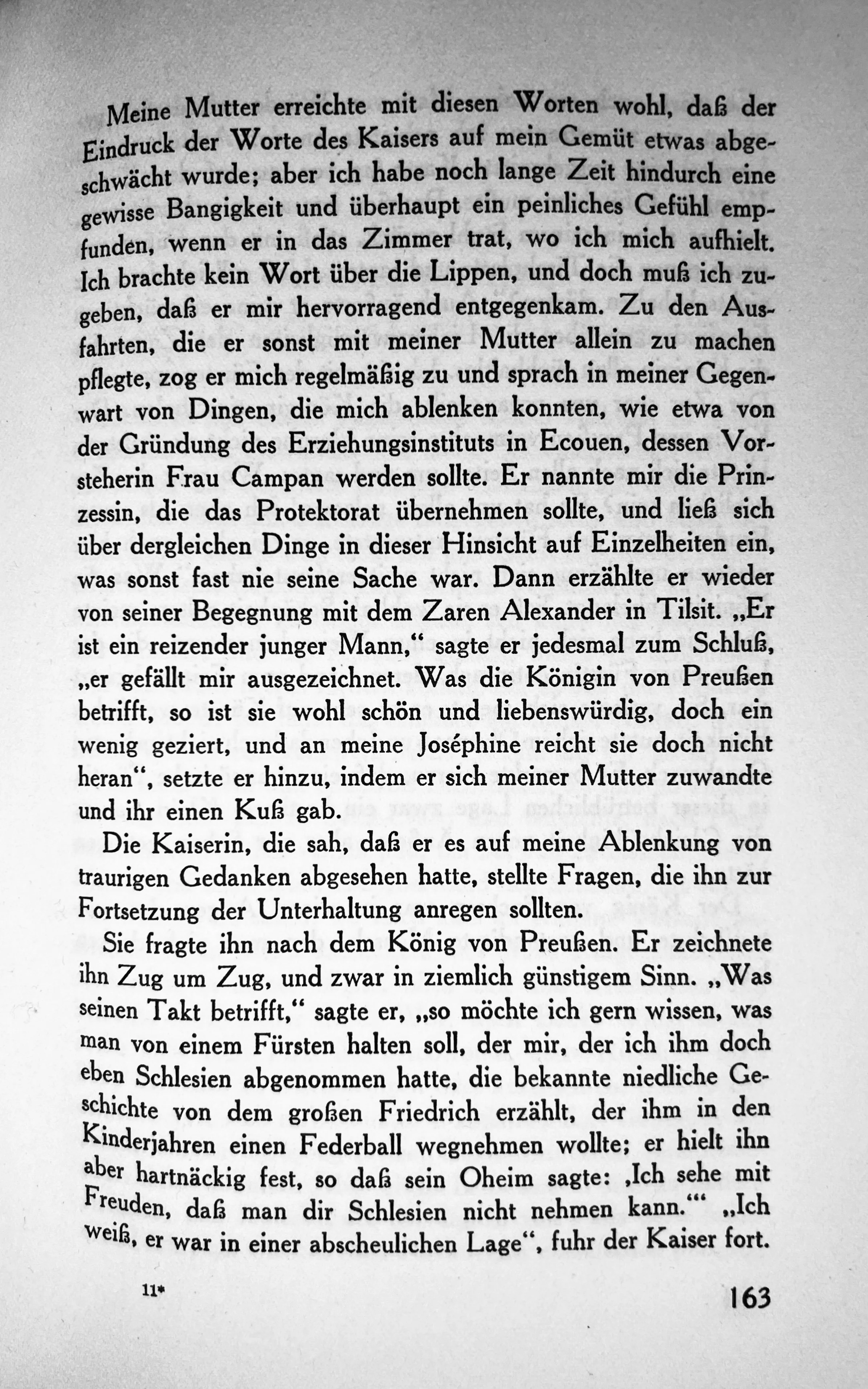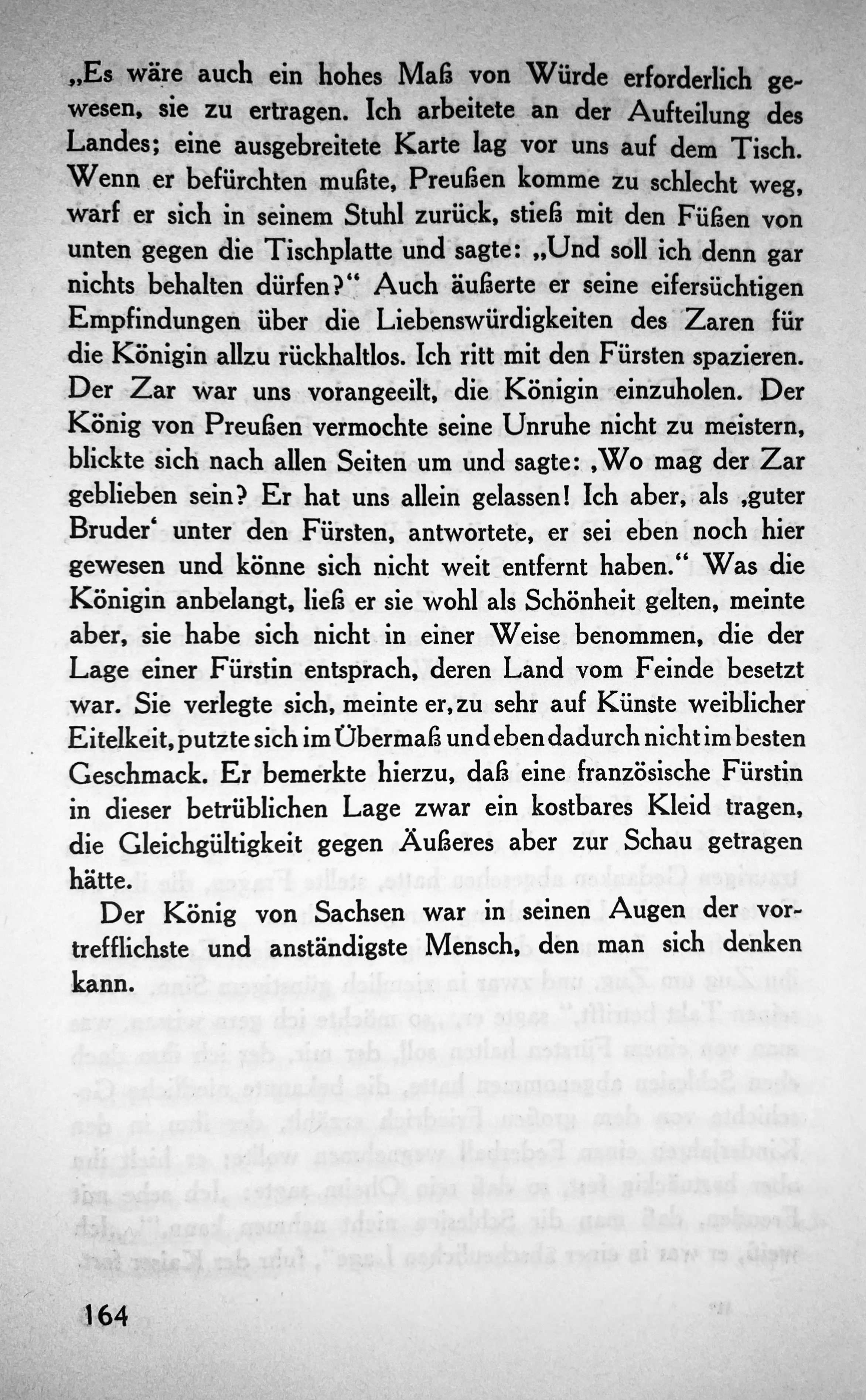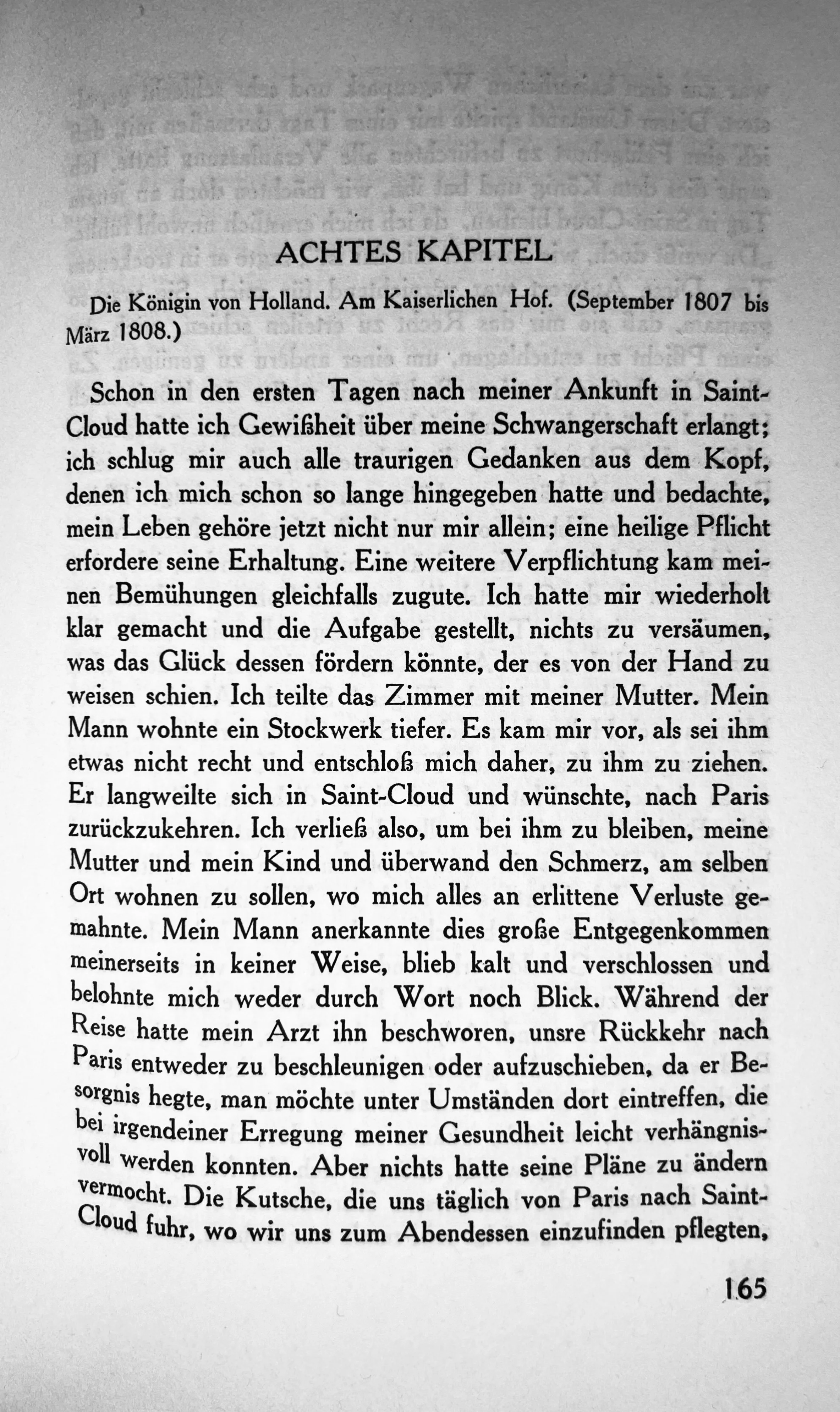After Hortense loses her son, she basically also loses her will to live. Upon seeing her again, Napoleon thought it would be a good idea that would benefit her to snap her out of it by telling her to stop crying so much. This strategy was not a successful one.
It is where Napoleon was over emotional and highly distraught that he would tend to overdo it the other way.
This led to him being viewed as unkind - even by Hortense - when he really was an ultra sensitive person, extremely loving, but not that great at handling his own overpowering feelings, particularly concerning women.
lose Gruel verübt wurden. Dem Kaiser gebührt wahrhaftig Lob und Preis dafür, das er so arge Bürgerzwiste endgültig abstellte. Ich wünschte natürlich auch die Quellen von Vaucluse zu besichtigen und begab mich, während mein Mann Verse verfertigte und in Baumrinden einschnitt, nach dieser unscheinbaren Schlucht und trank mit insgeheim Schauder von ihrem Wasser. War der Quell etwa Zeuge der leidenschaftlichen Ergüsse eines empfindsamen Gemüts gewesen? Sollte die Erinnerung an die Quellen Ariosts imstande sein können, die lauterste Verständigkeit zu verstören? Ich weiß es nicht; ich berichte bloß, was ich erlebte. An Orten, wo andre viel geliebt haben, fühlt das Herz wohl seine eigne Liebeskraft viel stärker und hat vielleicht auch mehr Furcht davor. Mein Gemüt, in das ich mich damals tief versenkte, verriet mix, ich müsse mir noch viele Mühe geben, zu zerstören, was ich unterdrückt zu haben irrtümlich glaubte. Als wir das einsame Vaucluse verliessen, das eigentlich nur durch Lauras und Petrarcas Liebe eine Stätte geworden ist, an der man gerne weilt, kamen wir in eine kleine Stadt, wo wir erkannt wurden. Das Volk spannte die Pferde aus und zog uns an deren Stelle mit einem Übereifer und Überschwang, wie er nur bei Südländern vorkommt. Wer hätte gedacht, daf wenige Jahre später in diesem damals so begeisterten Süden in Marschall von Frankreich ermordet werden und der Kaiser in Todesgefahr geraten würde! So sieht die Liebe des Volks aus, und doch will man gerade von ihm geliebt werden!
Zum Glück war dieser Triumphzug nicht von langer Dauer. Wir muften uns unsre Freiheit fast mit Gewalt erkaufen. Unser Inkognito wurde im Verlaufe der Weiterreise wieder hergestellt. Ich ließ in jeder Stadt, wo ich mich auf eine Jugendfreundin besinnen konnte, die dort wohnte, ihr sagen, sie möchte mich aufsuchen; es war mir dann immer eine außerordentliche Freude, diese meine alten Gespielinnen in die Arme zu schliessen.
Wir waren in Lyon angekommen, und schon konnte ich die Mühen der Reise nicht mehr ertragen. Es war im August. Ich litt erheblich unter der übergrofen Hitze.
Die geringe Aufmerksamkeit, die mir mein Mann erwies, ließ mich erkennen, wie wenig ich von der erfolgten Aussöhnung zu erhoffen hatte.
Die Liebe, die er für mich zu empfinden behauptete, schien mir mit dieser geringen Rücksichtnahme schlecht verträglich. So ging mir denn mein Lebensmut immer mehr verloren, statt das er in mir erwacht wäre. Eines Tags brach unser Wagen, und wir wurden beinahe in einen Abgrund geschleudert. Ich blieb sitzen, ohne mich zu erregen und dachte: „So wäre es dennsoweit!" Aber es kam anders, und wir entgingen der Gefahr.
Dann überraschte uns in entsetzliches Unwetter. Es blitzte so unaufhörlich und so grell, da man fürchten musste, zu erblinden. Das Gewitter war auf seinem Höhepunkt angelangt.
Ich dachte an den willkommenen Tod und erwartete mit einer Art Genuf den Blitzschlag, dem ich ihn verdanken würde. Wie unglücklich muss man sich doch fühlen und wie zerrissen muss nicht ein Gemüt sein, um kalten Bluts zu einem Lebensverzicht zu gelangen, der der Natur so sehr zuwiderläuft! Es sollte aber nicht lange währen, und ich wurde wieder andrer Eindrücke und Gedanken fähig.
Abends kamen wir in Saint-Cloud an. Alles war ins Theater gegangen. Meine Mutter verließ die Vorstellung, um mich zu begrüßen. Mein Söhnchen wurde mir in tiefem Schlaf überbracht. Ich drückte es ans Herz, und die Rührung, die mich beim Eindruck so liber und herzlicher Anteilnahme überkam, das ich meine Fähigkeit zu empfinden zurückgewonnen hatte.
Ich weinte heisse Tränen, als der Kaiser eintrat. „Nun, da wären wir ja wieder", sagte er hocherfreut. Wie er mich aber Küste, sah er mich immer noch weinen. „So gib doch", sagte er ernst, „diese Kindereien endlich auf; deinen Sohn hast du jetzt hinlänglich beweint; es wird allmählich lächerlich mit dir. Wills du denn eine Nina der Mutterliebe werden? Du bist doch nicht die einzige Mutter, der dies Unglück widerfahren ist; aber die Mütter haben sonst Mut, besonders wenn sie noch etwas zu lieben übrig behalten und, wie du, Pflichten haben. Du hast ein Kind, das deiner Pflege bedarf, ein Königreich, das dich wiederhaben will, und eine Mutter, der du das Herz schwer machst. Ich muss gestehen, ich vermisse bei dir die Kraft, die ich erwartet hatte. Weshalb machst du denn Gebirgsreisen, statt bei der Mutter und deinem Kind zu bleiben? Du hast unbilligerweise nicht bei ihnen allein Trost gesucht; ich hätte das alles überhaupt nicht gestattet, wenn ich hier gewesen wäre. Aber nun bist du wieder daheim. Sei also fröhlich, gib dich den Vergnügungen hin, die deinem Alter entsprechen, und da du keine Tränen mehr sehen lässt!" Nachdem er mir so die Leviten gelesen hatte, zog er sich zurück und ante nicht, was er mir damit angetan hatte. Ich hörte freilich auf zu weinen, aber es kam mir dafür ein Gedanke, schmerzlicher als irgendeiner: „Das also ist die Güte des Kaisers!" sagte ich zu meiner Mutter. „Ich hätte ihn für besser gehalten; er hat ja offenbar keinen Begriff von Mutterliebe. Man kann mir doch, sollte ich glauben, meine Tränen nicht verargen. Ich habe ja kaum geweint, und wenn er meine so natürliche Ergriffenheit, wie ich wieder bei euch war, nicht versteht, so verschliesst er sich eben den selbstverständlichsten Empfindungen; begreift er dergleichen etwa nicht? Ich kann mir freilich vorstellen, das die Äußerungen meines Schmerzes ihm lästig fallen: Ich will auch gar nicht hierbleiben. Ich möchte fort." Meine Mutter gab sich alle Mühe, mich zu beruhigen.
„Du verstehst den Kaiser nicht; er meint, du hättest dich in deinen Schmerz hineingesteigert, indem du dich ihm gar zu sehr hingabst. Er hatte mir schon gesagt, er were sich einer strengen Rede befleißigen müssen; es sei das einzige Mittel, dich zurecht zu bringen. Aber glaube nur nicht, das er an unserem Kummer keinen Anteil nimmt. Er hat sehr oft mit mir darüber geredet, und er hat sich sogar aus Teilnahme für dich so hart gezeigt.“ Meine Mutter erreichte mit diesen Worten wohl, das der Eindruck der Worte des Kaisers auf mein Gemüt etwas abgeschwächt wurde; aber ich habe noch lange Zeit hindurch eine gewisse Bangigkeit und überhaupt ein peinliches Gefühl empfunden, wenn er in das Zimmer trat, wo ich mich aufhielt.
Ich brachte kein Wort über die Lippen, und doch muss ich zugeben, das er mir hervorragend entgegenkam. Zu den Ausfahrten, die er sonst mit meiner Mutter allein zu machen pflegte, zog er mich regelmäßig zu und sprach in meiner Gegenwart von Dingen, die mich ablenken konnten, wie etwa von der Gründung des Erziehungsinstituts in Ecouen, dessen Vorsteherin Frau Campan werden sollte. Er nannte mir die Prinzessin, die das Protektorat übernehmen sollte, und ließ sich über dergleichen Dinge in dieser Hinsicht auf Einzelheiten ein, was sonst fast nie seine Sache war. Dann erzählte er wieder von seiner Begegnung mit dem Zaren Alexander in Tilsit. „Er ist ein reizender junger Mann,“ sagte er jedesmal zum Schluss, „er gefällt mir ausgezeichnet. Was die Königin von Preußen betrifft, so ist sie wohl schön und liebenswürdig, doch ein wenig geziert, und an meine Joséphine reicht sie doch nicht heran"', setzte er hinzu, indem er sich meiner Mutter zuwandte und ihr einen Kuss gab.
Die Kaiserin, die sah, das er es auf meine Ablenkung von traurigen Gedanken abgesehen hatte, stellte Fragen, die ihn zur Fortsetzung der Unterhaltung anregen sollten.
Sie fragte ihn nach dem König von Preußen. Er zeichnete ihn Zug um Zug, und zwar in ziemlich günstigem Sinn. „Was seinen Takt betrifft," sagte er, „so möchte ich gern wissen, was man von einem Fürsten halten soll, der mir, der ich ihm doch eben Schlesien abgenommen hatte, die bekannte niedliche Geschichte von dem großen Friedrich erzäblt, der ihm in den Kinderjahren einen Federball wegnehmen wollte; er hielt ihn aber hartnäckig fest, so dass sein Oheim sagte: ,“Ich sehe mit Freuden, das: man dir Schlesien nicht nehmen kann.“ „Ich weiß, er war in einer abscheulichen Lage", fuhr der Kaiser fort. „Es wäre auch ein hohes Maß von Würde erforderlich gewesen, sie zu ertragen. Ich arbeitete an der Aufteilung des Landes; eine ausgebreitete Karte lag vor uns auf dem Tisch.
Wenn er befürchten musste, Preußen komme zu schlecht weg, warf er sich in seinem Stuhl zurück, stieß mit den Füßen von unten gegen die Tischplatte und sagte: „,Und soll ich denn gar nichts behalten dürfen?" Auch äuferte er seine eifersüchtigen Empfindungen über die Liebenswürdigkeiten des Zaren für die Königin allzu rückhaltlos. Ich ritt mit den Fürsten spazieren.
Der Zar war uns vorangeeilt, die Königin einzuholen. Der König von Preußen vermochte seine Unruhe nicht zu meistern, blickte sich nach allen Seiten um und sagte: ,Wo mag der Zar geblieben sein? Er hat uns allein gelassen! Ich aber, als, guter Bruder' unter den Fürsten, antwortete, er sei eben noch hier gewesen und könne sich nicht weit entfernt haben." Was die Königin anbelangt, ließ er sie wohl als Schönheit gelten, meinte aber, sie habe sich nicht in einer Weise benommen, die der Lage einer Fürstin entsprach, deren Land vom Feinde besetzt war. Sie verlegte sich, meinte er, zu sehr auf Künste weiblicher Eitelkeit, putzte sich im Übermaß un eben dadurch nicht im besten Geschmack. Er bemerkte hierzu, da eine französische Fürstin in dieser betrüblichen Lage zwar ein kostbares Kleid tragen, die Gleichgültigkeit gegen Äußeres aber zur Schau getragen hätte.
Der König von Sachsen war in seinen Augen der vortrefflichste und anständigste Mensch, den man sich denken kann.
ACHTES KAPITEL
Die Königin von Holland. Am Kaiserlichen Hof. (September 1807 bis März 1808.)
Schon in den ersten Tagen nach meiner Ankunft in Saint-Cloud hatte ich Gewissheit über meine Schwangerschaft erlangt; ich schlug mir auch alle traurigen Gedanken aus dem Kopf, denen ich mich schon so lange hingegeben hatte und bedachte, mein Leben gehöre jetzt nicht nur mir allein; eine heilige Pflicht erfordere seine Erhaltung. Eine weitere Verpflichtung kam meinen Bemühungen gleichfalls zugute. Ich hatte mir wiederholt klar gemacht und die Aufgabe gestellt, nichts zu versäumen, was das Glück dessen fördern könnte, der es von der Hand zu weisen schien. Ich teilte das Zimmer mit meiner Mutter. Mein Mann wohnte ein Stockwerk tiefer. Es kam mir vor, als sei ihm etwas nicht recht und entschloss mich daher, zu ihm zu ziehen.
Er langweilte sich in Saint-Cloud und wünschte, nach Paris zurückzukehren. Ich verließ also, um bei hm zu bleiben, meine Mutter und mein Kind und überwand den Schmerz, am selben Ort wohnen zu sollen, wo mich alles an erlittene Verluste gemahnte. Mein Mann anerkannte dies grofe Entgegenkommen meinerseits in keiner Weise, blieb kalt und verschlossen und belohnte mich weder durch Wort noch Blick. Während der Reise hatte men Arzt ihn beschworen, unsre Rückkehr nach Paris entweder zu beschleunigen oder aufzuschieben, da er Besorgnis hegte, man möchte unter Umständen dort eintreffen, die be irgendeiner Erregung meiner Gesundheit leicht verhängnisvoll werden konnten. Aber nichts hatte seine Pläne zu ändern vermocht. Die Kutsche, die uns täglich von Paris nach Saint-Cloud fuhr, wo wir uns zum Abendessen einzufinden pflesten,