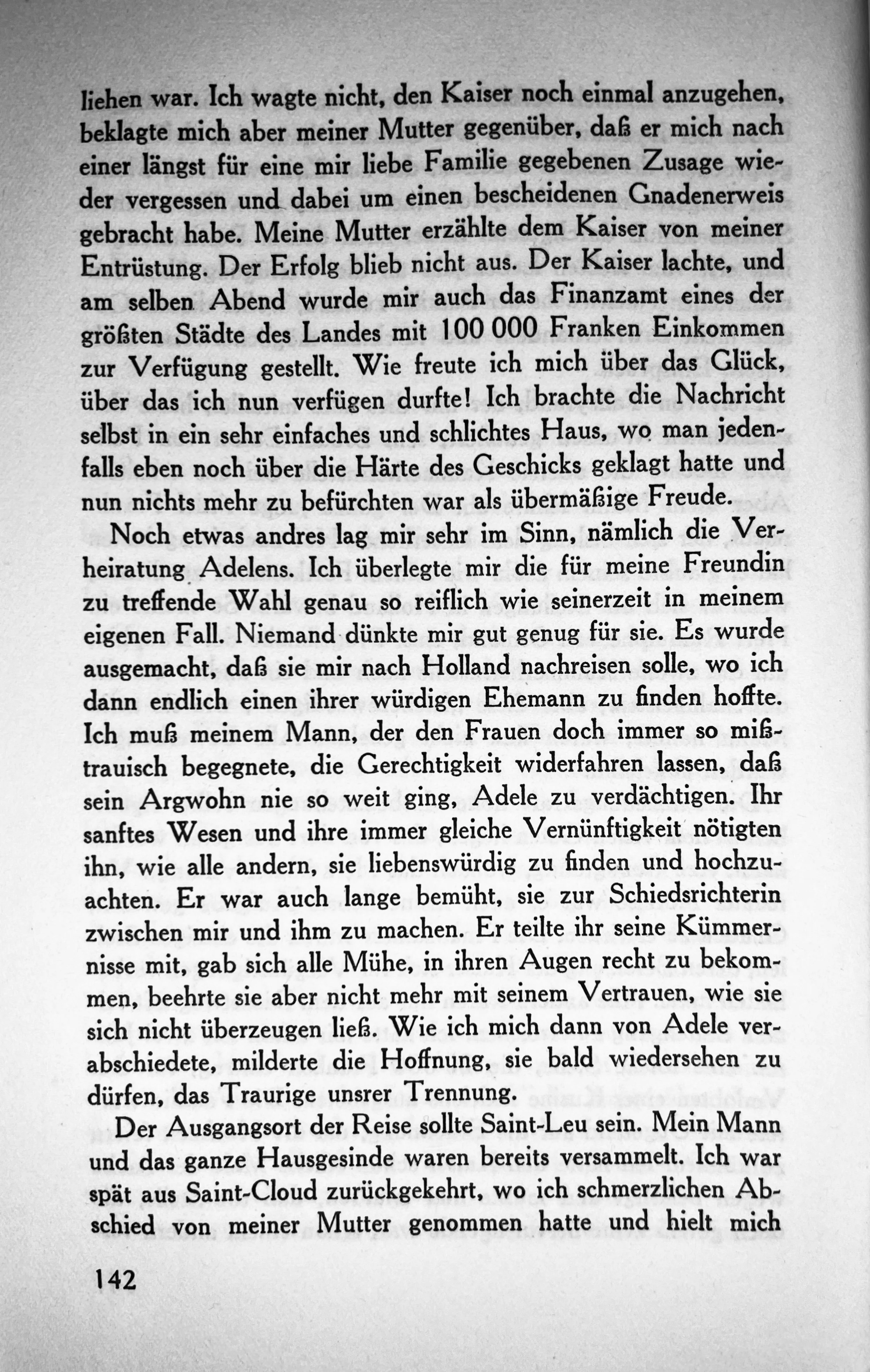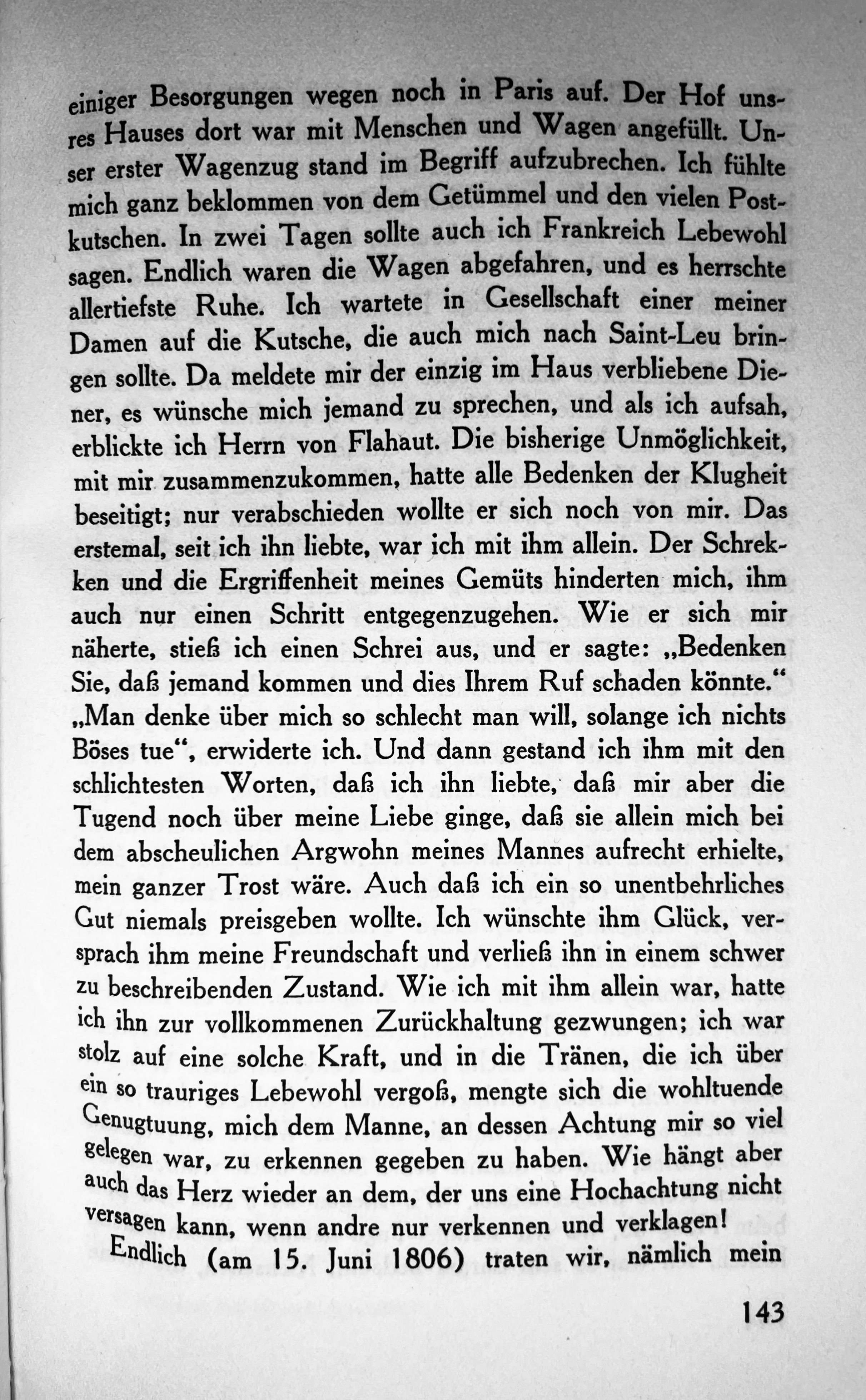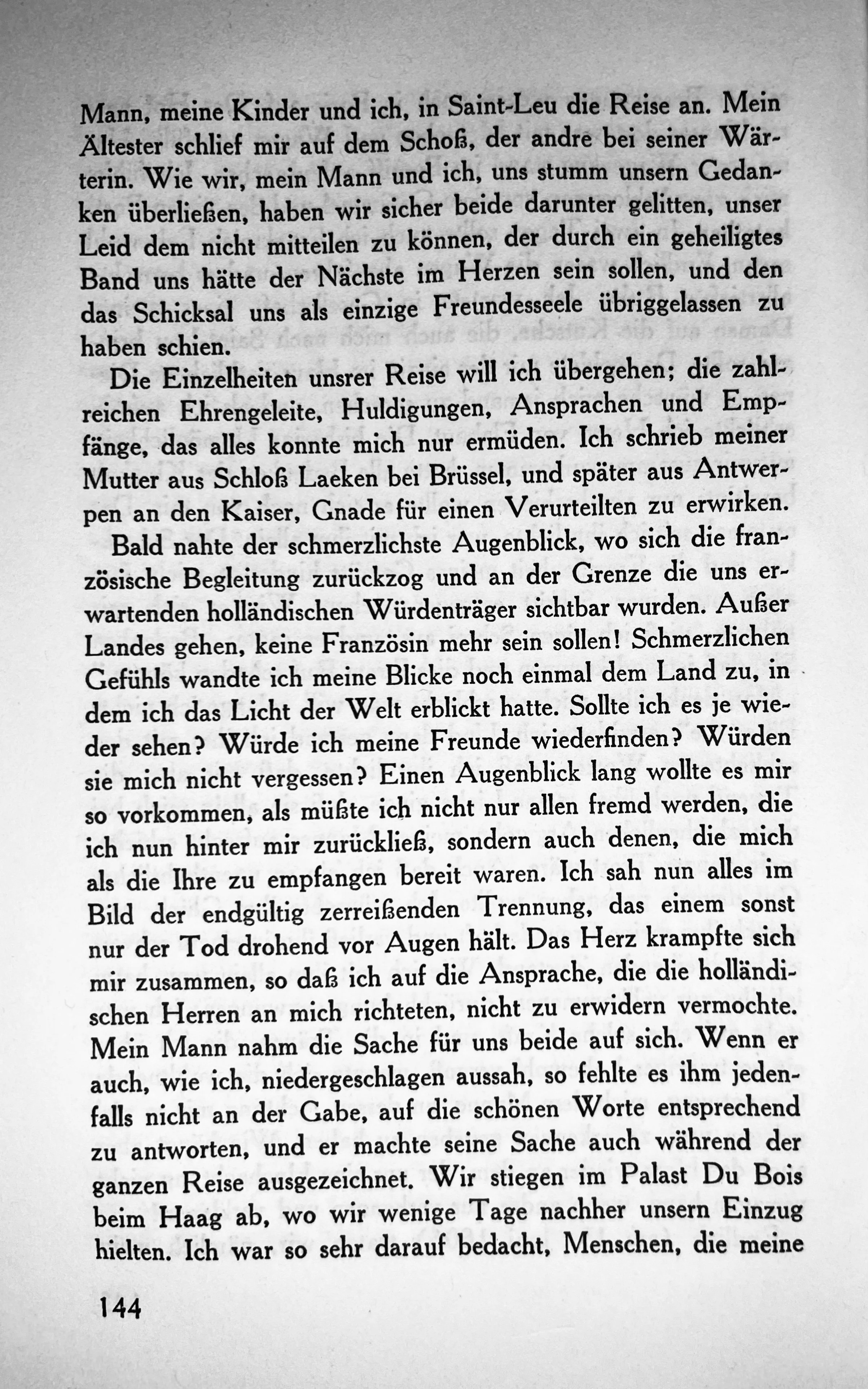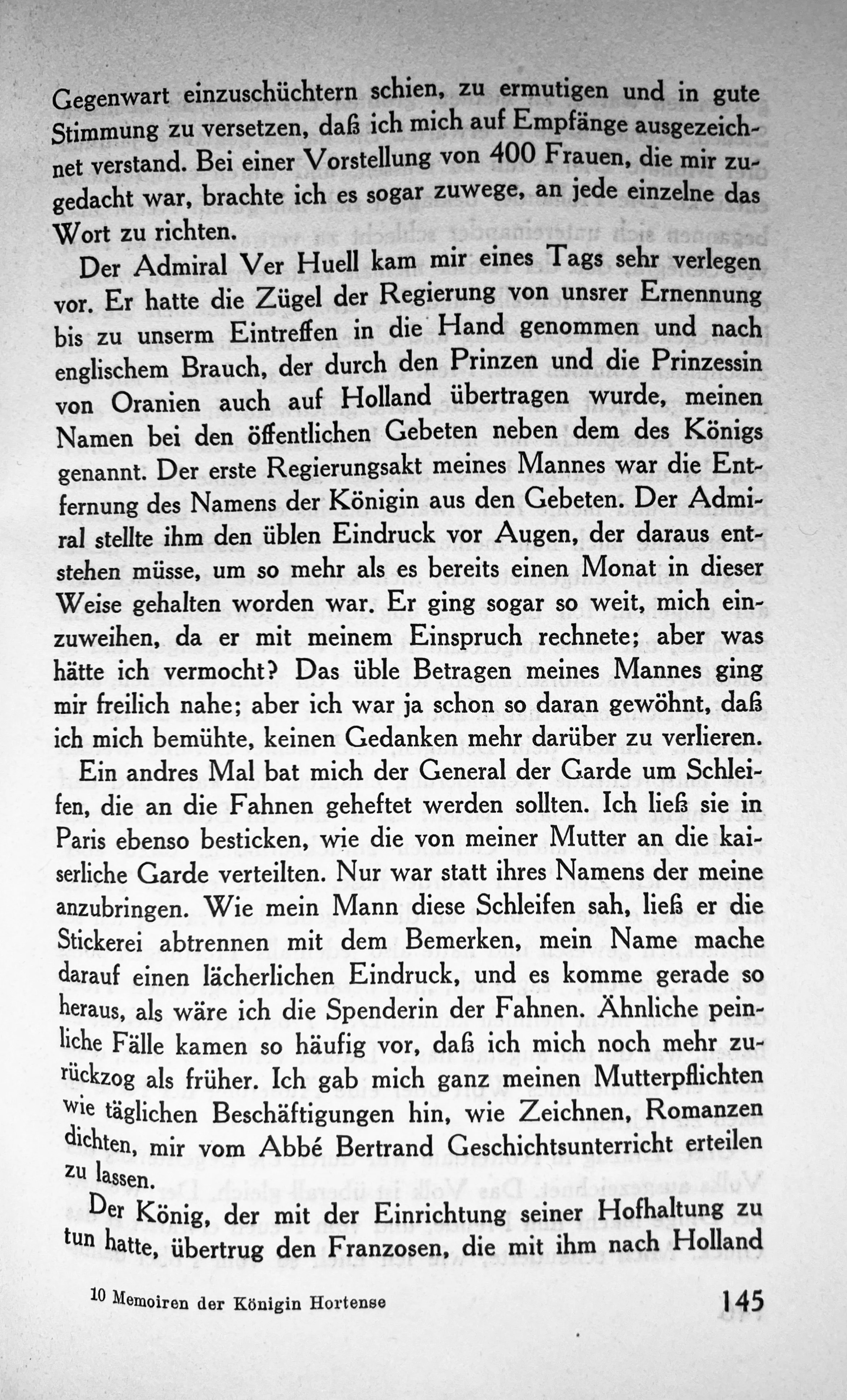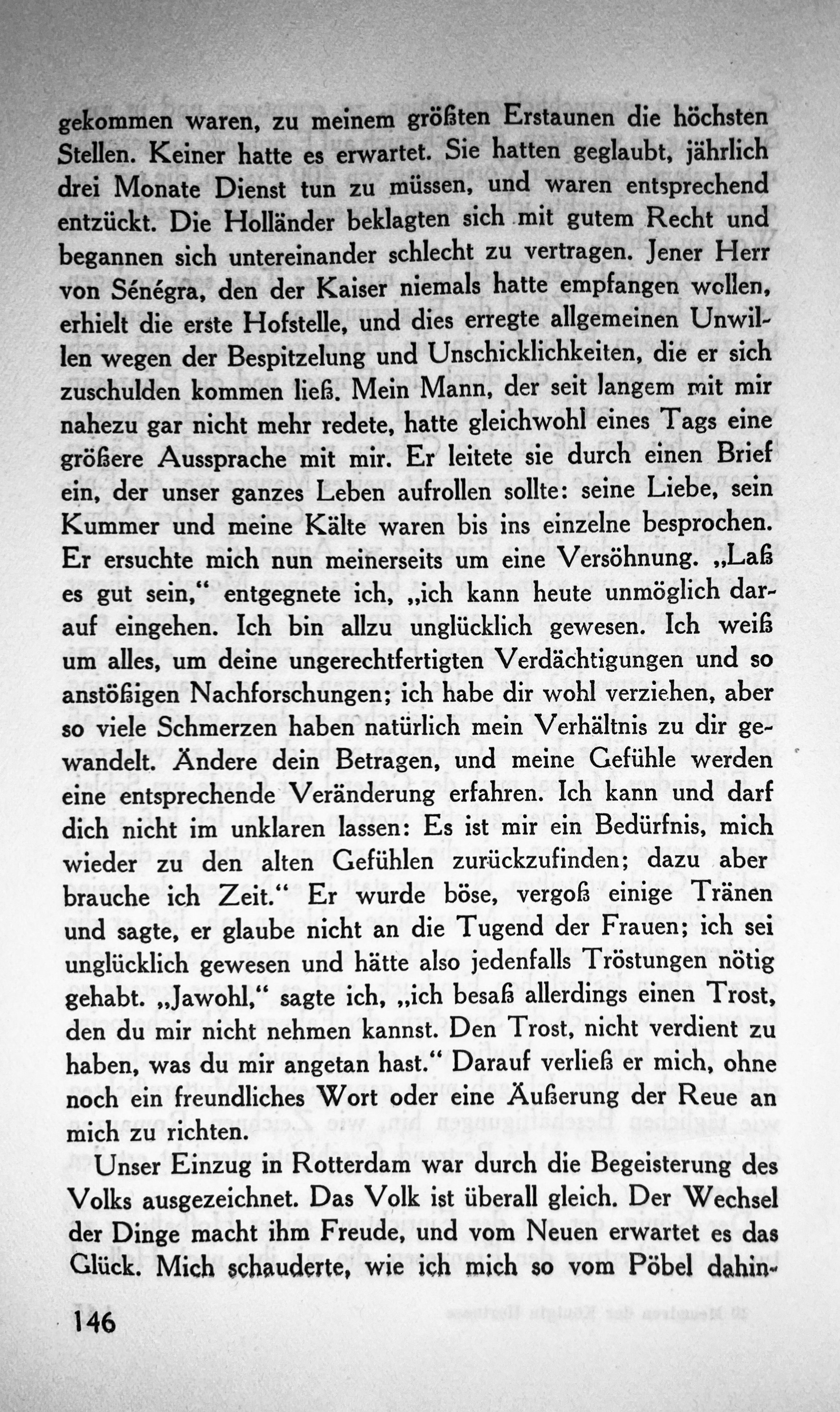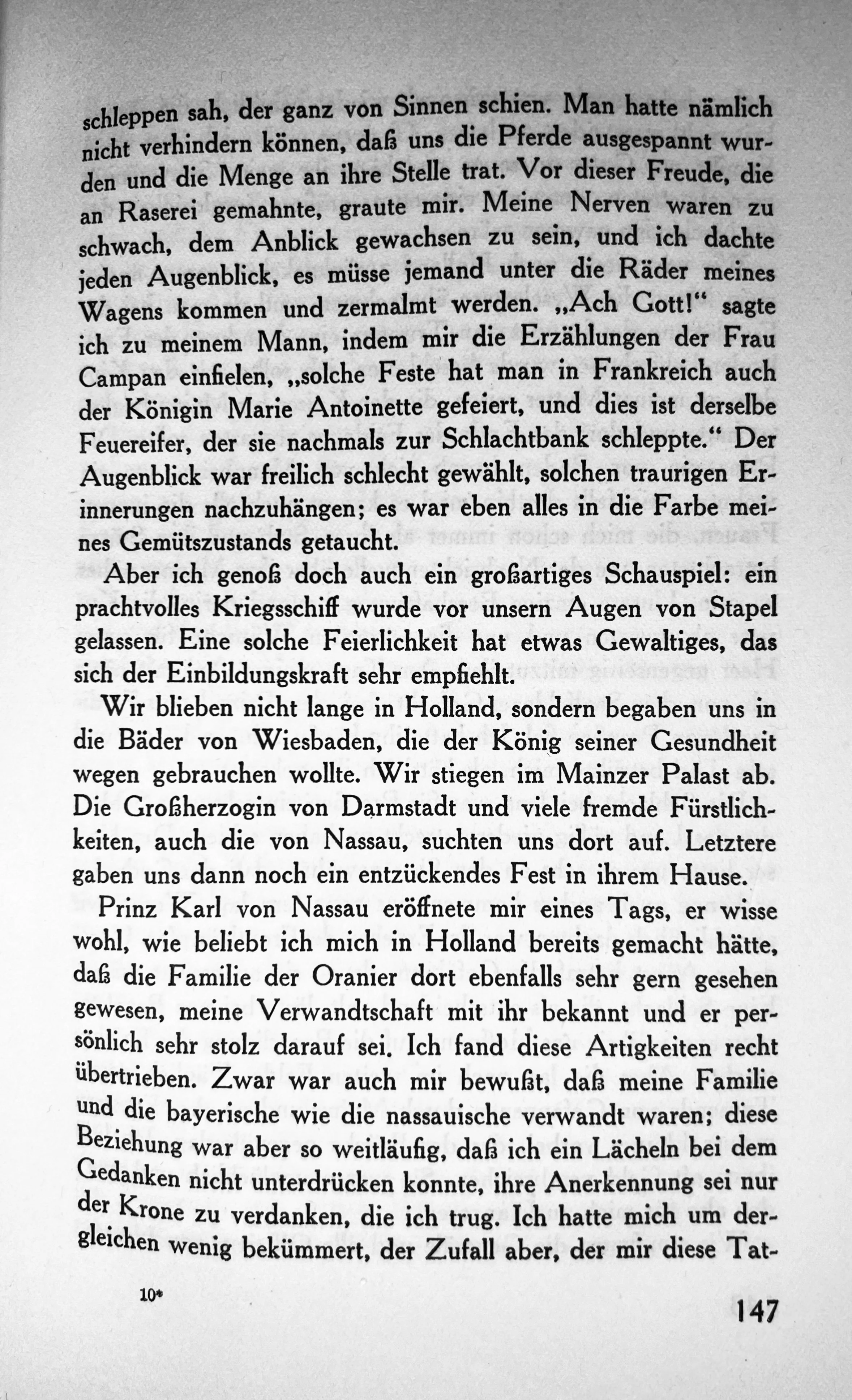Louis could not handle his situation.
liehen war. Ich wagte nicht, den Kaiser noch einmal anzugehen, beklagte mich aber meiner Mutter gegenüber, da er mich nach einer längst für eine mir liebe Familie gegebenen Zusage wieder vergessen und dabei um einen bescheidenen Gnadenerweis gebracht habe. Meine Mutter erzählte dem Kaiser von meiner Entrüstung. Der Erfolg blieb nicht aus. Der Kaiser lachte, und am selben Abend wurde mir auch das Finanzamt eines der größten Städte des Landes mit 100 000 Franken Einkommen zur Verfügung gestell. Wie freute ich mich über das Glück, über das ich nun verfügen durfte! Ich brachte die Nachricht selbst in ein sehr einfaches und schlichtes Haus, wo man jedenfalls eben noch über die Härte des Geschicks geklagt hatte und nun nichts mehr zu befürchten war als übermäßige Freude.
Noch etwas andres lag mir sehr im Sinn, nämlich die Verheiratung Adelens. Ich überlegte mir die für meine Freundin zu treffende Wahl genau so reiflich wie seinerzeit in meinem eigenen Fall. Niemand dünkte mir gut genug für sie. Es wurde ausgemacht, daf sie mir nach Holland nachreisen solle, wo ich dann endlich einen ihrer würdigen Ehemann zu finden hoffte.
Ich muss meinem Mann, der den Frauen doch immer so misstrauisch begegnete, die Gerechtigkeit widerfahren lassen, das sein Argwohn nie so weit ging, Adele zu verdächtigen. Ihr sanftes Wesen und ihre immer gleiche Vernünftigkeit nötigten ihn, wie alle andern, sie liebenswürdig zu finden und hochzuachten. Er war auch lange bemüht, sie zur Schiedsrichterin zwischen mir und ihm zu machen. Er teilte ihr seine Kümmernisse mit, gab sich alle Mühe, in ihren Augen recht zu bekommen, beehrte sie aber nicht mehr mit seinem Vertrauen, wie sie sich nicht überzeugen lie. Wie ich mich dann von Adele verabschiedete, milderte die Hoffnuns, sie bald wiedersehen zu dürfen, das Traurige unsrer Trennung.
Der Ausgangsort der Reise sollte Saint-Leu sein. Mein Mann und das ganze Hausgesinde waren berets versammelt. Ich war spät aus Saint-Cloud zurückgekehrt, wo ich schmerzlichen Abschied von meiner Mutter genommen hatte und hielt mich einiger Besorgungen wegen noch in Paris auf. Der Hof unsres Hauses dort war mit Menschen und Wagen angefüllt. Unser ester Wagenzug stand im Begriff aufzubrechen. Ich fühlte mich ganz beklommen von dem Getümmel und den vielen Postkutschen. In zwei Tagen sollte auch ich Frankreich Lebewohl sagen. Endlich waren die Wagen abgefahren, und es herrschte allertiefste Ruhe. Ich wartete in Gesellschaft einer meiner Damen auf die Kutsche, die auch mich nach Saint-Leu bringen sollte. Da meldete mir der einzig im Haus verbliebene Diener, es wünsche mich jemand zu sprechen, und als ich aufsah, erblickte ich Herr von Flahaut. Die bisherige Unmöglichkeit, mit mir zusammenzukommen, hatte alle Bedenken der Klugheit beseitigt; nur verabschieden wollte er sich noch von mir. Das erstemal, seit ich in liebte, war ich mit ihm allein. Der Schrekken und die Ergriffenheit meines Gemüts hinderten mich, ihm auch nur einen Schritt entgegenzugehen. Wie er sich mir näherte, stief ich einen Schrei aus, und er sagte: „,Bedenken Sie, das jemand kommen und dies Ihrem Ruf schaden könnte.“
„Man deke über mich so schlecht man will, solange ich nichts Böses tue", erwiderte ich. Und dann gestand ich ihm mit den schlichtesten Worten, das ich ihn liebte, das mir aber die Tugend noch über meine Liebe ginge, das sie allein mich bei dem abscheulichen Argwohn meines Mannes aufrecht erhielte, mein ganzer Trost wäre. Auch das ich ein so unentbehrliches Gut niemals preisgeben wollte. Ich wünschte ihm Glück, versprach hm meine Freundschaft und verließ ihn in einem schwer zu beschreibenden Zustand. Wie ich mit ihm allein war, hatte ich ihn zur vollkommenen Zurückhaltung gezwungen; ich war stolz auf eine solche Kraft, und in die Tränen, die ich über ein so trauriges Lebewohl vergoss, mengte sich die wohltuende Genugtuung, mich dem Manne, an dessen Achtung mir so viel gelegen war, zu erkennen gegeben zu haben. Wie hängt aber auch das Herz wieder an dem, der uns eine Hochachtung nicht versagen kann, wen andre nur verkennen und verklagen!
Endlich (am 15. Juni 1806) traten wir, nämlich mein Mann, meine Kinder und ich, in Saint-Leu die. Reise an. Mein Ältester schlief mir auf dem Schoß, der andre bei seiner Wärterin. Wie wir, mein Mann und ich, uns stumm unsern Gedanken überließen, haben wir sicher beide darunter gelitten, unser Leid dem nicht mitteilen zu können, der durch ein geheiligtes Band uns hätte der Nächste im Herzen sein sollen, und den das Schicksal uns als einzige Freundesseele übriggelassen zu haben schien.
Die Einzelheiten unsrer Reise will ich übergehen; die zahlreichen Ehrengeleite, Huldigungen, Ansprachen und Empfänge, das alles konnte mich nur ermüden. Ich schrieb meiner Mutter aus Schloß Laken bei Brüssel, und später aus Antwerpen an den Kaiser, Gnade für einen Verurteilten zu erwirken.
Bald nahte der schmerzlichste Augenblick, wo sich die französische Begleitung zurückzog und an der Grenze die uns erwartenden holländischen Würdenträger sichtbar wurden. Ausser Landes gehen, keine Französin mehr sein sollen! Schmerzlichen Gefühls wandte ich meine Blicke noch einmal dem Land zu, in dem ich das Licht der Welt erblickt hatte. Sollte ich es je wieder sehen? Würde ich meine Freunde wiederfinden? Würden sie mich nicht vergessen? Einen Augenblick lang wollte es mir so vorkommen, als müsste ich nicht nur allen fremd werden, die ich nun hinter mir zurückließ, sondern auch denen, die mich als die Ihre zu empfangen beret waren. Ich sah nun alles im Bild der endgültig zerreifenden Trennung, das einem sonst nur der Tod drohend vor Augen hält. Das Herz krampfte sich mir zusammen, so das ich auf die Ansprache, die die holländischen Herren an mich richteten, nicht zu erwidern vermochte.
Mein Mann nahm die Sache für uns beide auf sich. Wenn er auch, wie ich, niedergeschlagen aussah, so fehlte es ihm jedenfalls nicht an der Gabe, auf die schönen Worte entsprechend zu antworten, und er machte seine Sache auch während der ganzen Reise ausgezeichnet. Wir stiegen im Palast Du Bois beim Haag ab, wo wir wenige Tage nachher unsern Einzug hielten. Ich war so sehr darauf bedacht, Menschen, die meine Gegenwart einzuschüchtern schien, zu ermutigen und in gute Stimmung zu versetzen, daß ich mich auf Empfänge ausgezeichnet verstand. Bei einer Vorstellung von 400 Frauen, die mir zugedacht war, brachte ich es sogar zuwege, an jede einzelne das Wort zu richten.
Der Admiral Ver Huell kam mir eines Tags sehr verlegen vor. Er hatte die Zügel der Regierung von unsrer Ernennung bis zu unserm Eintreffen in die Hand genommen und nach englischem Brauch, der durch den Prinzen und die Prinzessin von Oranien auch auf Holland übertragen wurde, meinen Namen bei den öffentlichen Gebeten neben dem des Königs genannt. Der erste Regierungsakt meines Mannes war die Entfernung des Namens der Königin aus den Gebeten. Der Admiral stellte ihm den üblen Eindruck vor Augen, der daraus entstehen müsse, um so mehr als es berets einen Monat in dieser Weise gehalten worden war. Er ging soar so weit, mich einzuweihen, da er mit meinem Einspruch rechnete; aber was hätte ich vermocht? Das üble Betragen meines Mannes ging mir freilich nahe; aber ich war ja schon so daran gewöhnt, daß ich mich bemühte, keinen Gedanken mehr darüber zu verlieren.
Ein andres Mal bat mich der General der Garde um Schleissen, die an die Fahnen geheftet werden sollten. Ich lie sie in Paris ebenso besticken, wie die von meiner Mutter an die kaiserliche Garde verteilten. Nur war statt ihres Names der meine anzubringen. Wie mein Mann diese Schleifen sah, liess er die Stickerei abtrennen mit dem Bemerken, men Name mache darauf einen lächerlichen Eindruck, und es komme gerade so heraus, als wäre ich die Spenderin der Fahnen. Ähnliche peinliche Fälle kamen so häufig vor, das ich mich noch mehr zurückzog als früher. Ich gab mich ganz meinen Mutterpflichten wie täglichen Beschäftigungen hin, wie Zeichnen, Romanzen dichten, mir vom Abbé Bertrand Geschichtsunterricht erteilen zu lassen.
Der König, der mit der Einrichtung seiner Hofhaltuns zu tun hatte, übertrug den Franzosen, die mit ihm nach Holland gekommen warn, zu meinem größten Erstaunen die höchsten Stellen. Keiner hatte es erwartet. Sie hatten geglaubt, jährlich drei Monate Dienst tun zu müssen, und waren entsprechend entzückt. Die Holländer beklagten sich mit gutem Recht und begannen sich untereinander schlecht zu vertragen. Jener Herr von Sénégra, den der Kaiser niemals hatte empfangen wollen, erhielt die erste Hofstelle, und dies erregte allgemeinen Unwillen wegen der Bespitzelung und Unschicklichkeiten, die er sich zuschulden kommen ließ. Mein Mann, der seit langem mit mir nahezu gar nicht mehr redete, hatte gleichwohl eines Tags eine größere Aussprache mit mir. Er leitete sie durch einen Brief ein, der unser ganzes Leben aufrollen sollte: seine Liebe, sein Kummer und meine Kälte warn bis ins einzelne besprochen.
Er ersuchte mich nun meinerseits um eine Versöhnung. „Lass es gut sein“, entgegnete ich, „ich kann heute unmöglich darauf eingehen. Ich bin allzu unglücklich gewesen. Ich weiss um alles, um deine ungerechtfertigten Verdächtigungen und so anstößigen Nachforschungen; ich habe dir wohl verziehen, aber so viele Schmerzen haben natürlich mein Verhältnis zu dir gewandelt. Ändere dein Betragen, und meine Gefühle werden eine entsprechende Veränderung erfahren. Ich kann und darf dich nicht im unklaren lassen: Es ist mir ein Bedürfnis, mich wieder zu den alten Gefühlen zurückzufinden; dazu aber brauche ich Zeit."
Er wurde böse, vergoss einige Tränen und sagte, er glaube nicht an die Tugend der Frauen; ich sei unglücklich gewesen und hätte also jedenfalls Tröstungen nötig gehabt. „Jawohl," sagte ich, „ich besaß allerdings einen Trost, den du mir nicht nehmen kannst. Den Trost, nicht verdient zu haben, was du mir angetan hast.
"Darauf verließ er mich, ohne noch ein freundliches Wort oder eine Äußerung der Reue an mich zu richten.
Unser Einzug in Rotterdam war durch die Begeisterung des Volks ausgezeichnet. Das Volk ist überall gleich. Der Wechsel der Dinge macht ihm Freude, und vom Neuen erwartet es das Glück. Mich schauderte, wie ich mich so vom Pöbel dahin schleppen sah, der ganz von Sinnen schien. Man hatte nämlich nicht verhindern können, das uns die Pferde ausgespannt wurden und die Menge an ihre Stelle trat. Vor dieser Freude, die an Raserei gemahnte, graute mir. Meine Nerven waren zu schwach, dem Anblick gewachsen zu sein, und ich dachte jeden Augenblick, es müsse jemand unter die Räder meines Wages kommen und zermalmt werden. „Ach Gott!" sagte ich zu meinem Mann, indem mir die Erzählungen der Frau Campan einfielen, „solche Feste hat man in Frankreich auch der Königin Marie Antoinette gefeiert, und dies ist derselbe Feuereifer, der sie nachmals zur Schlachtbank schleppte.’
Der Augenblick war freilich schlecht gewählt, solchen traurigen Erinnerungen nachzuhängen; es war eben alles in die Farbe meines Gemütszustands getaucht. Aber ich genof doch auch ein großartiges Schauspiel: ein prachtvolles Kriegsschiff wurde vor unsern Augen von Stapel gelassen. Eine solche Feierlichkeit hat etwas Gewaltiges, das sich der Einbildungskraft sehr empfiehlt. Wir blieben nicht lange in Holland, sondern begaben uns in die Bäder von Wiesbaden, die der König seiner Gesundheit wegen gebrauchen wollte. Wir stiegen im Mainer Palast ab.
Die Großherzogin von Darmstadt und viele fremde Fürstlichkeiten, auch die von Nassau, suchten aus dort auf. Letztere gaben uns dann noch ein entzückendes Fest in ihrem Hause.
Prinz Karl von Nassau eröffnete mir eines Tags, er wisse wohl, wie beliebt ich mich in Holland berets gemacht hätte, das die Familie der Oranier dort ebenfalls sehr gern gesehen gewesen, meine Verwandtschaft mit ihr bekannt und er persönlich sehr stolz darauf sei. Ich fand diese Artigkeiten recht übertrieben. Zwar war auch mir bewusst, da meine Familie und die bayerische wie die nassauische verwandt waren; diese Beziehung war aber so weitläufig, da ich ein Lächeln bei dem Gedanken nicht unterdrücken konnte, ihre Anerkennung sei nur der Krone zu verdanken, die ich trug. Ich hatte mich um dergleichen wenig bekümmert, der Zufall aber, der mir diese Tat-