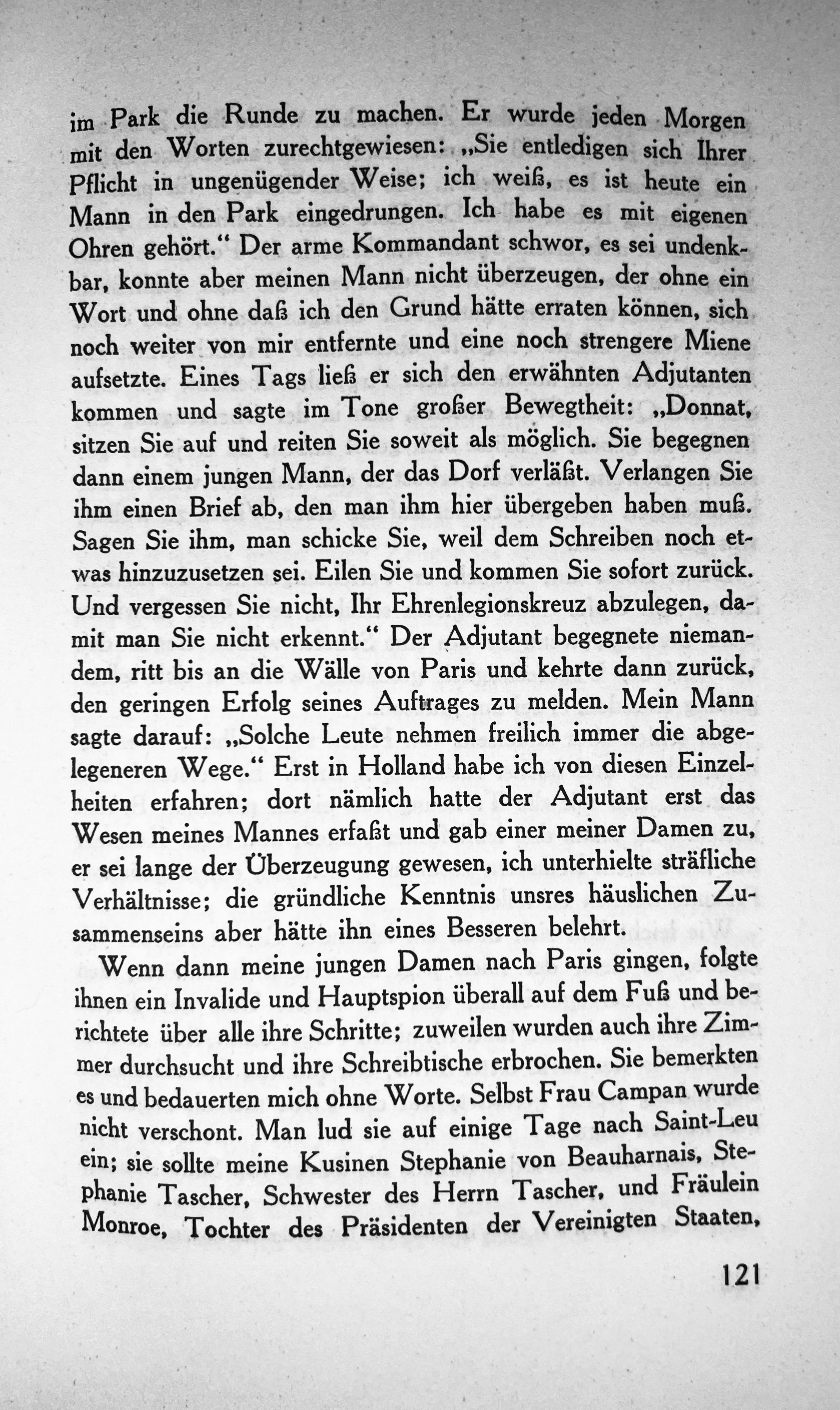In this passage, Napoleon expects Hortense to embarrass herself with an affair.
gehalten; aber der Kummer, den mir sein Anblick noch immer verursachte, ließ mich leider erkennen, das dies nicht der Fall war. Ich nahm mir vor, künftig so natürlich mit ihm zu verkehren wie mit jedem andern, und zog ihn beim ersten Ball, wo ich in wieder traf, ins Gespräch. Meine Stimme war etwas unsicher; doch war ich froh, mich einigermaßen in der Hand gehabt zu haben. Beim zweiten Ball lie ich um einen Tanz bitten. Er sagte mir beim Walzer, wie unglücklich ich ihn durch meine Koketterie gemacht habe. Ich war entsetzt, mich einer Untugend bezichtigen hören zu müssen, die ich am meisten von allen verachtete. „Ich und kokett!" sagte ich. „Jawohl, Sie hatten mir hr Wohlwollen geschenkt, und ich verlangte nicht mehr. Es beglückte mich ... und dann schien es mit einem Male, als wäre ich in Ihren Augen hassenswert geworden.“ Ich fühlte, das ich ihm das Recht gegeben haben konnte, so von mir zu denken; aber das Menschenherz ist unbegreiflich wunderlich. Geliebt wollte ich nicht werden; ich hatte Angst vor allem, was der Liebe glich; und dennoch, nach so vielen Kämpfen und Leiden, tat mir der bloße Vorwurf einer hassenswerten Untugend so weh, da ich den Ball, meine Stellung und alle auf mich gerichteten Augen vergaß und den Tränen nicht wehren konnte. Ich fühlte, nicht ohne Schrecken, wie sie mir die Wangen herab rollten. Was hätte ich denen antworten sollen, die mich gefragt haben würden, weshalb ich weinte?
Herr von Flahaut war noch bewegter als ich. Im Augenblick hatte er mehr begriffen, als ich ihm hatte sagen wollen. „Ich war Ihnen nicht ganz gleichgültig; weshalb haben Sie es mich nicht wissen lassen? Sie hätten mir bittere Schmerzen erspart, und heute, wo ich doch niemanden liebe als Sie, bin ich einer andern verpflichtet.“ „Nein, nein, ich liebe Sie nicht!" rief ich aus. „Wenn ich es auch eine Zeitlang glaubte, so ist es heute nicht mehr der Fall, glauben Sie es mir." - „So schenken Sie mir Ihre Freundschaft,“ sagte er, „sie wird mich für alles Verlorene entschädigen." Ich sagte sie ihm zu, und wir trennten uns. Diese
Aussprache hatte mir die Ruhe einigermaßen zurückgegeben. Ich fürchtete nichts mehr von einem Mann, der mir das Verhältnis mit einer andern gestand, und dieser Vertrauensbeweis bestätigte mir seine Achtung und Freundschaft. Ich wollte ja nicht mehr. Aber was regt das Gefühl, dessen wir Herr werden wollen, nicht alles für Gegengefühle und Kämpfe in uns auf!
Niemand ante meine Bewegtheit. Ich allein wußte darum. Der Kaiser, dem wie allen andern die Veränderung auffiel, die mit mir vor sich gegangen war, sagte zu meiner Mutter, die mir später seine Äusserung wiederholte: „Hortense hat ihre schönen Farben eingebüßt. Ihr Mann macht sie nicht glücklich, und wir erleben vielleicht noch einmal etwas ganz Arges. Wenn die liebt, wird es eine starke Leidenschaft, und die Liebe lässt den Menschen grosse Torheiten begehen.“ - „Aber du weißt doch, sagte meine Mutter, „wie vernünftig Hortense ist!" - „Gewiss, aber die Leidenschaften sind riesenstark."
„,Sie ist doch so sanft und gelassen. Sie geht niemals einen Augenblick aus sich heraus." - „…Verlass dich lieber nicht darauf; sieh, wie sie geht. Hör, wenn sie spricht. Alles an ihr ist Gefühl, sonst wäre sie a nicht deine Tochter.“
Bei diesem Bericht meiner Mutter hielt ich die Augen gesenkt. Ein Lächeln war meine ganze Antwort; meine Hoffnung aber, die Worte des Kaisers Lügen strafen zu können. Vor der Abreise nach Saint-Leu hatte mein Mann von mir verlangt, ich solle meine erste Kammerzofe entlassen, und zwar nur, weil sie ihm nicht gefiel und ihm immer so vorkäme, als machte sie sich über ihn lustig. Er ersetzte sie mir durch eine andre, die ich heute noch habe; ire Vorgängerin brachte ich bei meiner Mutter unter; es tat mir sehr leid, mich von ihr trennen zu sollen. Vor einiger Zeit hatte ich mir als Vorleserin Fräulein Cochelet in Dienst genommen, die in Saint-Germain mit mir in der Anstalt gewesen war; sie empfahl sich mir durch ihre schwierige Vermögenslage und die rührende Sorgfalt, mit der sie ihre Mutter während einer langen Krankheit gepflegt hatte. Ich wollte schon immer jemanden um mich haben, den ich dann mit einer Mitgift auszustatten und zu ver heiraten gedachte. Da dies aus meiner Schatulle geschehen sollte, hatte men Mann nichts dagegen gehabt. Meine Damen und Kinderwärterinnen warn jung an Jahren, und mein ganzes Hauswesen hatte einen frohsinnigen Zug. Die Strenge des Prinzen Louis war war bemerkt worden; aber was war denn zu fürchten, wenn man nichts zu verbergen hatte? Alle gingen also mit Freuden nach Saint-Leu. Bis dahin war unser Hausstand nur klein, und ihn kennen zu lernen war nicht gut möglich gewesen; in Paris galt unser häusliches Dasein als Mustereheleben. Man machte mir nur den Vorwurf, gegen einen so guten Mann etwas kaltsinnig zu sein, und diese Kälte schrieb man wieder auf Rechnung meiner schlechten Gesundheit.
Nach den Wochen schenkte mir Louis einen Diamantschmuck, der mir keine Freude machte, her das Gegenteil. Es wäre mir weit lieber gewesen, statt der zur Schau getragenen Zeichen eines guten Einvernehmens, das doch nicht bestand, mehr Sorglosigkeit beschert zu bekommen. Meine Damen machten mir freimütig Vorwürfe, ich hätte zu wenig Dankbarkeit gezeigt; aber nur ich war die Verletzte; denn ich litt, ohne zu klagen.
In Saint-Leu gingen den Leuten allmählich die Augen auf: Der Dienst dort war das reine Festungsleben. Waren die Damen allein im Garten spazieren gegangen, hänselte sie mein Mann mit anzüglichen Reden. Ich begab mich eines Tags mit zweien von ihnen ins Freie. Eine der Türen des Parks war nur lose befestigt; sie wollten sie öffnen, um gegen den Wald hin zu gehen. Ein harmloses Vergnügen, gegen das ich nichts einzuwenden hatte; wir gingen auch nur ein paar Schritte im Gehölz spazieren und kamen gleich wider zurück. Doch schon war man auf der Suche nach uns, und am nächsten Tag war die Tür vermauert. Ein andres Mal wünschte ein junger Mensch, Überbringer einer Bittschrift, eine meiner Damen zu sprechen. Man wies ihn ab, beschrieb seine äußere Erscheinung und ließ ihn beobachten. Einer der Adjutanten meines Mannes, Donnat mit Namen, der Schloss-Kommandant war, hatte nachts im Park die Runde zu machen. Er wurde jeden Morgen mit den Worten zurechtgewiesen: „Sie entledigen sich Ihrer Pflicht in ungenügender Weise; ich weiß, es ist heute ein Mann in den Park eingedrungen. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört.“ Der arme Kommandant schwor, es sei undenkbar, konnte aber meinen Mann nicht überzeugen, der ohne ein Wort und one das ich den Grund hätte erraten können, sich noch weiter von mir entfernte und eine noch strengere Miene aufsetzte. Eines Tags ließ er sich den erwähnten Adjutanten kommen und sagte im Tone großer Bewegtheit: „Donnat, sitzen Sie auf und reiten Sie soweit als möglich. Sie begegnen dann einem jungen Mann, der das Dorf verlässt. Verlangen Sie ihm einen Brief ab, den man ihm hier übergeben haben muß. Sagen Sie ihm, man schicke Sie, weil dem Schreiben noch etwas hinzuzusetzen sei. Eilen Sie und kommen Sie sofort zurück. Und vergessen Sie nicht, Ihr Ehrenlegionskreuz abzulegen, damit man Sie nicht erkennt." Der Adjutant begegnete niemandem, ritt bis an die Wälle von Paris und kehrte dann zurück, den geringen Erfolg seines Auftrages zu melden. Mein Mann sagte darauf: „Solche Leute nehmen freilich immer die abgelegeneren Wege." Erst in Holland habe ich von diesen Einzelheiten erfahren; dort nämlich hatte der Adjutant erst das Wesen meines Mannes erfasst und gab einer meiner Damen zu, er sei lange der Überzeugung gewesen, ich unterhielte sträfliche Verhältnisse; die gründliche Kenntnis unsres häuslichen Zusammenseins aber hätte in eines Besseren belehrt.
Wenn dann meine jungen Damen nach Paris gingen, folgte ihnen in Invalide und Hauptspion überall auf dem Fuß und berichtete über alle ihre Schritte; zuweilen wurden auch ihre Zimmer durchsucht und ihre Schreibtische erbrochen. Sie bemerkten es und bedauerten mich one Worte. Selbst Frau Campan wurde nicht verschont. Man lud sie auf einige Tage nach Saint-Leu ein; sie sollte meine Kusinen Stephanie von Beauharnais, Stephanie Tascher, Schwester de Herr Tascher, und Fräulein Monroe, Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten, mitbringen. Während ihrer Abwesenheit wurde ihrer Zofe angesonnen, für 50 000 Franken Belohnung angebliche Briefe und Bildnisse herauszugeben, die Frau Campan für mich in Verwahrung haben sollte. Die Zofe konnte freilich mit nichts dergleichen aufwarten. Später wurde auch die Polizei in diese Dinge eingeweiht. Wo wäre die Frau, die man schließlich nicht doch um ihren guten Ruf bringen könnte, und deren guter Name solche Angriffe überstünde? Freilich erntet ein Mensch, der sich abscheulichem Argwohn überläft, mur Leiden und Qualen. Weit entfernt, sich in der Überzeugung zufrieden zu geben, er müsse sich geirrt haben, da er ja die gesuchten Beweise nie erhält, erbost er sich vielmehr, wird immer hartnäckiger, versteift sich nur auf das eine: Wisen zu wollen, was gar nicht ist.
Da er Böses tut, braucht er Verfehlungen auf der andern Seite, sein Opfer muß zugleich schuldig sein. Sein Gewissen wäre beruhigt, wenn er um eine Schuld wüßte. Gegen den Vorwurf der Ungerechtigkeit geschützt, würde er sich selbstgefällig einreden, er sei nur grausam.
Ich erhielt aber anderseits von Herrn von Flahaut einen inhaltsreichen und höchst zartsinnigen Brief. Er verstand den Schmerz, den mir die Trennung von einem geliebten Bruder kostete. Er nahm den lebhaftesten Anteil, und mein Kummer traf mit seinem Bedauern zusammen, sich von einem geliebten Freunde trennen zu sollen.
Wie leicht läßt sich doch ein leidendes Gemüt rühren! Ich glaubte, in dem, der mich jetzt so freundlich anhörte, den ruder wiederzugewinnen, den ich verlor. Und bei diesem trostreichen Gedanken fand ich nichts Arges darin, ihm zu antworten. Es war mein ester Brief; der reinsten Freundschaftsempfindung wurde gestattet, was der Liebe niemals zugestanden worden wäre.
Meinem Mann wurden damals die Bäder von Saint-Amand verordnet. Wir begaben uns dorthin, liefen unsern Jüngsten unter der Aufsicht der Frau von Boubers zurück und nahmen nur den Älteren mit, ferner Adele und Fräulein Cochelet. In Mortefontaine machten wir Station beim Prinzen Joseph. Ich ließ an Frau Campan schreiben und ihr Nachricht von uns geben. Mein Kammerdiener nahm den Brief in Empfang und übergab ihn meinem Mann, den meine Damen im Park bei der Lektüre überraschten. Wie wir in Saint-Amand ankamen, sah ich, wie derselbe Mensch, der eine meiner Damen geheiratet hatte, alle meine Briefschaften durchsuchte. Wie ich ihn so auf der Tat ertappte, warf er sich mir zu Füßen, sagte, ich könnte ihn ja jetzt vernichten, aber er handle ja doch nur im Auftrag seines Herrn, gestand, es seen ihm hundert Louis versprochen, wenn er etwas gegen mich Zeugendes entdeckte. Ich war so erstaunt und empfand solche Demütigung für meinen Mann, weil er es gewagt hatte, sich derart zu erniedrigen, da ich ihn noch mehr bedauerte als mich selbst, weil er einer so entsetzlichen Leidenschaft Gehör gab. Ich entgegnete dem Mann, er könne seine Obliegenheiten ruhig weiter betreiben, da er ja nur dem Prinzen gehorche; ich würde nicht darauf achten. Konnte ich wohl auf die Hochachtung von seiten des Ehemannes, früher mein dringendstes Bedürfnis, auf diese so wertvolle und erst zu verdienende gute Meinung noch soviel geben, nachdem ich so viel Verkehrtes hatte mit ansehen müssen?
Später hat mich dann bessere Weltkenntnis und Bekanntschaft mit der verzerrenden Wirkung der Leidenschaft selbst bei vortrefflichen Menschen nachsichtiger denken gelehrt. Ehedem verzieh ich, weil es sich um meinen Mann handelte und es meine Pflicht war. Nachmals fand ich für ihn Entschuldigungen in seinem schlechten Gesundheitszustand; da ich aber nun mein eigenes Urteil gewonnen hatte, gelang es mir allmählich, auf das seine zu verzichten, von dessen Wertschätzung er mich ja selbst immer mehr zurückbrachte. Eines Tags betraf ich einen seiner Sekretäre dabei, wie er meine Briefe entsiegelte; und ich erhielt doch nur solche von meiner Mutter